|
|
Geologische
Strukturen
|
Das
Untersuchungsgebiet ist Teil der durch die mesozoischen Gesteinsschichten
aufgebauten süddeutschen
Schichtstufenlandschaft. [-->
Einfaches Modell der Entstehung für die Schule]
Deutlich auf dem
Satellitenbild lässt sich der Verlauf der Keuperstufe westlich von
Nürnberg, die durch das Untersuchungsgebiet (rot umrandet) nach
Südwesten
verläuft, bei Crailsheim dann nach Westen bzw. nach Nordwesten
umbiegt
und sich bis Heilbronn anhand der bewaldeten Rahmenhöhen verfolgen
lässt.
Der Verlauf der Stufe der Frankenhöhe
und ihrer nördlichen Fortsetzung des Steigerwaldes springt wie im
Bereich von Rothenburg oder nördlich im Bereich des
Bullenheimer
Berges nach Westen vor, während sie dazwischen wie z. B. bei Bad
Windsheim
nach Osten zurückweicht. Darin machen sich großräumige
Verbiegungen der süddeutschen Großscholle
bemerkbar.
Verfolgt
man den
Verlauf der bewaldeten Gebiete, so erkennt
man manche regelmäßige und linienhafte Anordnung der
Waldgebiete.
Der
Verlauf
erfolgt im wesentlichen NW-SO. Dieser Verlauf lässt
zwei Erklärungsvarianten zu:
- Die bewaldeten Gebiete zeichnen Höhenrücken nach,
die
Täler
der konsequent entwässernden
Gebiete der Frankenhöhe begleiten.
- Die bewaldeten Gebiete zeichnen Höhenrücken nach,
die
teils von
Tälern begleitet aber tektonische Störungen
nachzeichnen.
Auffällig
ist die Linie Heilbronn - Südrand des Rieses aber auch
im Untersuchungsgebiet selbst.
Den
Zusammenhang
mit herzynisch
streichenden Störungen
bei Frommetsfelden östlich von Ansbach und Schillingsfürst
kann
man in der geologischen Karte nachweisen.Mit Phantasie kann man am
Nordrand
des UG bis Nürnberg bewaldete Gebiete mit erzgebirgischer
Streichrichtung
erkennen (Nordrand der Frankenhöhe vor der Windsheimer Bucht und
Biberttal
bis Nürnberg. |
Profil vom Spessart
zur Fränkischen Alb erzeugt aus GTOPO30-Daten des US-Geological
Survey - RSG-Programmers-Group
|
Im
Untersuchungsgebiet an der Oberfläche anstehend sind Gesteine
des Mesozoikums ab dem
Mittleren Muschelkalk
bis Blasensandstein des
Mittleren
Keupers. Ist der Muschelkalk nur im Bereich des Taubertales und
westlich
davon sowie den Seitentälern des Taubertales aufgeschlossen, so
bilden
die Unterlage der weitgespannten nach Osten hin geneigten Verebnung vor
der Frankenhöhe die Schichten des Unteren oder
Lettenkohlenkeupers.
Diese sind durch eine mehr oder weniger mächtige quartäre
Löss-
bzw. Lösslehmauflage überlagert.
Den Anstieg zur Stufe der Frankenhöhe bilden dann mit sanften
Hängen
die Myophorien und Estherienschichten, die in der Stufe selbst nochmals
eine Verebnung bilden. Den eigentlichen Anstieg zur
Frankenhöhe
bilden dann Schilfsandstein, Lehrbergschichten und Blasensandstein, der
eine breite, aber z. T. stark zerschnittene Verebnung bildet und
meistens
bewaldet ist.
Durch
rückwärtige
Zerschneidung des Schilf- und Blasensandsteins hat man auch auf der
rückwärtigen
Seite eine deutlich ausgeprägte Stufe, die dann im Geslauer Becken
erneut auf den Myophorien und Estherienschichten mündet
Nach CRAMER (1964, Erläuterungen zur Geologischen Karte 1: 500
000) liegt (vgl. noch einzufügende Abbildung) der Bereich der
Frankenhöhe
im UG geprägt zu sein durch einen Schnittpunkt unterschiedlicher
Biege-
(Mulden und Sättel) und Bruchtektonik (überwiegend
Aufschiebungen).
Dabei soll die Bruchtektonik im UG jünger sein als die
Biegetektonik
(HAUNSCHILD, Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1: 25
000 1964)
Von den
tektonischen Strukturen machen sich im Satellitenbild morphologisch/in
Wechsel der agrarischen Nutzung bemerkbar und damit
erkennbar:
- die Frommetsfeldener Störung, die im Gelände
selbst
über
rund 20 km verfolgbar ist,
- und südlich dieser eine kleinere Verwerfung, die sich
aber
im Nebental
der Altmühl fortsetzen könnte (die größere
Frankenheimer
Störungszone liegt außerhalb des Satellitenbildes.
Außer dem
Colmberger Schild in der nordwestlichen Fortsetzung des
Ansbacher Sattels lassen sich aus dem Satellitenbild keine weiteren
tektonischen
Strukturen ableiten. |
 |
| Taubertal bei
Tauberscheckenbach/Tauberzell
(April 2003) |
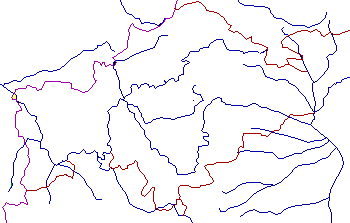
Der Main und seine
Nebenflüsse
- erzeugt mit unveröffentl.
Programmentwurf
"Geograph-Karte"
(DOS-TurboPascal) |
Die Tauber
"besitzt nach
FUGMANN (1988) ein Einzugsgebiet von 1.809,5 km2 Größe. Ihre
Quelle liegt auf der Ostabdachung der Hohenloher Ebene im Vorland der
Frankenhöhe
bei ca. 455 m ü. NN. Von dort aus fließt sie zuerst in der
Subsequenzzone
der Keuperstufe, dann erfolgt südlich Rothenburg eine starke
Eintiefung
um ca. 65 m in den Oberen Muschelkalk ..." (SPONHOLZ, 1997, a.a.O. S.51)
Die tertiäre
und pleistozäne
Reliefgenese im Bereich des Taubertales scheint eng verknüpft zu
sein
mit den Bewegungen der sog. "Süddeutschen Großscholle" sowie
tektonischen Verbiegungen.
Einen Überblick
über
den Forschungsstand über die post-jurassische
Landschaftsentwicklung
... gibt (KURZ, 1988, a.a. O. S. 18 ff)
Die Korrelation
älterer
Terrassen entlang der Flussläufe von Jagst und Kocher, die dem
Rhein
über den Neckar tributär sind und den Terrassen der Tauber,
die
über den Main ebenfalls dem Rheint tributär sind infolge der
tektonischen Bewegungen in den Abflussgebieten und ihren Vorflutern,
unterschiedlicher
Zeitpunkte der Umstellung der Entwässerungsrichtungen mehr als
fraglich.
(vgl. ....)
|
"Für das Tal der dem
Main tributären Tauber gibt JUNGBAUER (1983) in Anlehnung an
CARLE (1973) folgende Terrassensequenz an:
- 100 bis 160 m
über dem
Fluß vermutlich pliozäne Höhenschotter zwischen
Igersheim
und Schäftersheim
- 50 bis 70 m
und 20 bis 30 m
über dem Fluß altpleistozäne Terrassen.
- 5 bis 10 m
über dem Fluß
lößbedeckte Riß-Terrassen
- würmeiszeitliche
Kiessande
der Tauber im Bereich der Talsohle und wenig darüber"
(SPONHOLZ,
1997, a.a.O. S.51).
Die Maintalbildung
unter besonderer
Berücksichtigung der Terrassen untersuchen u. a. (KÖRBER
1962,
HEIM 1979 )
Ein älterer
Beitrag
mit Bildern zur Entstehung
des Maintales (Einleitung zu einer Zulassungsarbeit aus dem Jahr
1979)
|
 |
 |
| Hangverflachungen, die Terrassen der Nebenflüsse
der Tauber oberhalb der Niederterrasse sein könnten, sind an
mehreren
Nebenflüssen der Tauber - wie hier an ... bei ... beobachtbar. Bei
einer Geländebegehung im Rahmen der Facharbeit von Ralf Hahn
wurden
bei Tauberzell auch Windkantern auf Kalkstein beobachtet (Photo
hinzufügen!) |
Durch ... sind
hier bei
... zwei unterschiedliche Terrassenniveaus aufgeschlossen: ... |
 |
 |
| Selbst das nur
mit ... km
sehr "kurze" Vorbachtal als Nebenfluss der ... bildet eine deutliche
"Niederterrasse"
aus. |
Diese erscheint
in manchen
Abschnitten durchaus zweigeteilt, wie hier bei dieser "Kaskade" des
Vorbaches. |

|

|
Im Raum Tauberzell
weisen die Hänge eine in gleichem Niveau verlaufende
terrassenähnliche Verebnung auf, auf denen man Windkanter finden
kann. Im Übergang zum höher liegenden Steilhang war im
Jahr 2004 an einem neu angelegten Weganschnitt deutlich der
kantige Solifluktionsschutt bis Blockgröße aufgeschlossen.
Die im Anschnitt darüberliegende Bodenbildung zeigt an, dass nach
dem Ereignis der Solifluktion genug Zeit zur Bodenbildung blieg, also
eine Phase, in der sich kaum etwas in der Reliefgenese ereignete..
|

|

|
Die
Talränder der Tauber
sowie die Flächen beidseits der Tauber weisen in den durch
Muschelkalk geprägten Gebieten zahlreiche Dolinen
unterschiedlicher
Größe und Gestalt auf.
 |
 |
Unregelmässig
geformte
Doline bei
Bettenfeld im
südlich
des Schandtaubertales.
Hier konnte im
Frühjahr
2002 im Untergrund
das
Geräusch fließenden
Wassers festgestellt
werden. |
Eine
regelmäßige,
kreisrunde Form
zeigt diese
unter Waldbedeckung
vorzufindende Doline bei ... |
 |
SPONHOLZ
(1997 a. a. O S.
101 ff) verweist auf zahlreiche, nach der Größe und auch der
Relieflage bereits im Endtertärtär bereits angelegte
Großdolinen,
die später durch eingeschwemmte Sedimente plombiert und
verfüllt
wurden. Der Lk Ek 1998/2000 konnte bei einer Bohrung im Rahmen eines
Gelände-
und Laborpraktikums im Herbst des Jahres 1998 bei der Probennahme durch
der plombierten Großdoline (siehe Bild unten) durch Herrn Dr.
Erhard Schulz vom Geographischen Institut der Univeristät
Würzburg
teilnehmen. Im anschließenden Laborpraktikum, an dem der Autor
zeitweise
teilnehmen konnte, wurde festgestellt, dass das Material der
Verfüllung
die gesamte quartäre Landschaftsgeschichte der Umgebung seit dem
Ende
der Würmeiszeit dokumentiert.
|
Doline bei
... Dass diese
Doline noch
aktiv ist, konnte
im Frühjahr 2002 an frischem, nachgestürztem Material
beobachtet
werden. |
|

Großdoline
bei Adelshofen/Rothenburg
|
Die
holozäne Talgeschichte
wurde mit der Arbeit über "Die morphogenetische Wirksamkeit
historischer
Niederschläge" von HAHN,H.-U.(1992) am Beispiel der
Besselbergäcker
und der Grünbachau im unteren Taubertal beispielhaft
aufgearbeitet.
HAHN (1992) unterscheidet für den dortigen Beispielshang neben
allgemeinen
... , regional beschränkten extremalen Wetterereignissen,
sogeannanten
"Events" durch die Untersuchungen GLASERS ... belegt folgende durch den
Menschen beeinflusste Phasen der " quasinatürlichen
Rahmenbedingungen
wie Relief- und Bodenverhältnisse:
1. Die
Periode der
neolithischen bis keltischen Landnutzung.
2. Das
Frühmittelalter
mit dem beginnenden Wein- und Getreideanbau.
3. Die Periode vom
Hochmittelalter
bis zur Frühneuzeit mit intensiviertem Landbau sowie durch
Verbauung
und Terrassierung
der Reblagen.
4. Das 19.
Jahrhundert mit
der Besömmerung der Brache und der sukzessiven Aufgabe des
Weinbaus.
vgl. (Facharbeit von Hahn, R :
Weinbau
in Tauberzell)
5. Wiederbewaldung
der Unterhänge
und moderne Fruchtwechselwirtschaft an Ober- und Mittelhang in diesem
Jahrhundert.
" (HAHN, 1992, S. 40 ff)
Zu morphodynamischen Prozessen ab dem Mittelalter im
Untersuchungsgebiet: im Bereich der Karrach/Rothenburg
HAHN relativiert
hiermit insofern
die Übertragbarkeit von punktuell erhobenen Ergebnissen, als diese
durch räumlich eng beschränkte Ereignisse einerseits
beschränkt
wird. Man erinnere sich nur an die in die 90-er Jahren regional stark
durch
Wiebke betroffenen Gebiete im Raum Rothenburg . Andererseits sieht HAHN
die Entwicklung des Reliefs seit spätestens der neolithischen
Landnutzung
stark beeinflusst durch die jeweils bevorzugte Siedlungsaktivität
und die vorherrschende Agrarwirtschaft. Insofern wäre es mehr als
interessant an anderer Stelle des Taubertaleinzugsbereiches
vergleichende
Untersuchungen durchzuführen und Übereinstimmungen bzw.
Abweichungen
festzustellen.
Das Gebiet
Tauberzell um
Tauberzell erweist infolge der räumlichen Nähe zum
Keltenoppidum
Finsterlohr und der durch HAHN, R. (1988) dokumentierten
Siedlungsgeschichte
Tauberzells für vergleichende Untersuchungen mehr als geeignet, um
eventuell übereinstimmende bzw. abweichende Formungsprozesse
aufzuzeigen,
die letztendlich nur e i n Beitrag zur Aufhellung der
komplexen
holozänen Reliefgenese sein könnte. Angesichts nur
weniger
jüngerer Untersuchungen in diesem Raum erscheint dies mehr als
notwendig!
HEIM, 2004
|
| |
Zeitraum |
Untergliederung
nach
Pollenanalysen |
Beschreibung |
Besiedlungsgeschichte |
| Spätglazial |
20000 - 10000
v.Chr |
Ältere
Dryaszeit |
gegen Ende
tauchen erstmals
Birken-
und Kiefernpollen
auf, Rückgang
der Nichtbaumpollen (NBP) |
|
|
10000 - 9000
v.Chr. |
Allerödzeit |
starker
Rückgang der
NBP,
viel Birke und Kiefer |
|
|
|
Jüngere
Dryaszeit |
Anstieg der NBP,
Rückgang der
Bäume,
erneuter Eisvorstoß |
|
| Postglazial |
|
Vorwärmezeit
(Präboreal) |
erneut viel
Birke und Kiefer |
|
|
|
Frühe
Wärmzeit
(Boreal oder Haselzeit) |
starker Anstieg
der Haselpollen |
|
|
6000 - 1000
vChr |
Eichenmischwaldzeit
(Atlantikum) |
viel Pollen der
Arten der
Eichenmischwälder,
die Temperatur war
damals
noch etwas
höher als heute |
|
|
|
Späte
Wärmzeit
(Subboreal) |
Abkühlung
und langsam
Einwanderung
der Buche und Tanne |
|
|
|
Buchenzeit oder
Nachwärmezeit
(Subatlantikum) |
|
|
Quelle: ?
|
|
|
|
