|
Ein riesiges frühkeltisches Kalenderwerk wurde im
Fürstengrab von Magdalenenberg bei Villingen-Schwenningen
bei einer nachträglichen Grabungsauswertung am Römisch-Germanischen
Zentralmuseum Mainz entdeckt. Die Anordnung der Gräber
um das zentrale Fürstengrab stimmt mit den Sternenbildern
des nördlichen Himmels überein.
Im Gegensatz zu Stonehenge, welches sich am Verlauf der
Sonne orientierte, handelt es sich bei dem 100 Meter breiten
Grabhügel vom Magdalenenberg um die weltweit älteste
keltische Anlage, die auf die Mondzyklen ausgerichtet war.
Die Erbauer der Anlage setzten Stangenreihen auf den Hügel,
um die Mondwenden zu erfassen. Diese Himmelserscheinungen
waren bestimmend für die keltische Zeitrechnung. Durch
sie konnten die Kelten Mondfinsternisse voraussagen, wie
sie auch am 15. Juni 2011 in Deutschland zu sehen ist.
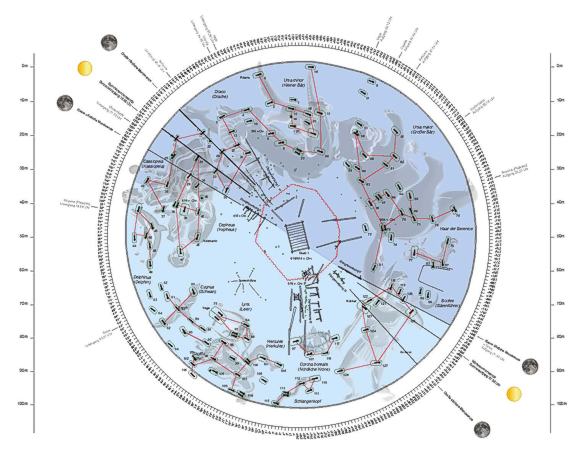
Der Sternenhimmel vom Magdalenenberg zeigt eine Sternenkonstellation,
die von der Wintersonnenwende bis zur Sommersonnenwende
nachts zu sehen ist. Dr. Allard Mees, Wissenschaftler am
Römisch-Germanischen Zentralmuseum, konnte mittels
Computerprogrammen den Stand des damaligen Sternenhimmels
und somit die Sternenbilder, die zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende
sichtbar waren, rekonstruieren. Mit Hilfe moderner astronomischer
Software konnte er so die Datierung der Anlage auf den
Sommer 618 v. Chr. bestimmen.
Schon Caesar berichtete über die mondbasierte Zeitrechnung
der keltischen Kultur. Durch die Eroberung Galliens und
die damit einhergehende Vernichtung der gallischen Kultur
geriet diese Art der Kalenderrechnung in Europa jedoch
in Vergessenheit. In der monumentalen Grabanlage Magdalenenberg
bei Villingen-Schwenningen tritt diese Mondkultur der Kelten
erstmals wieder ans Tageslicht.
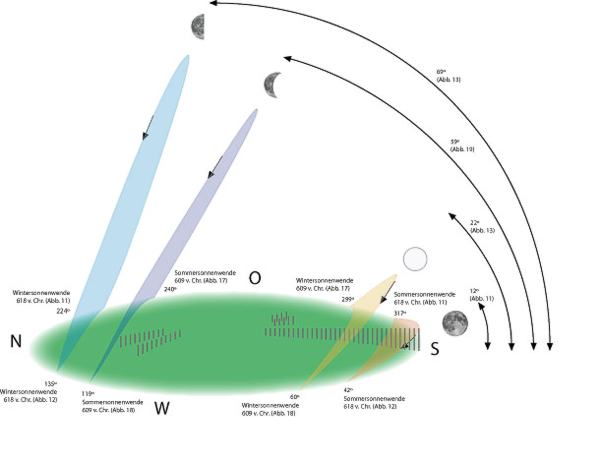
|