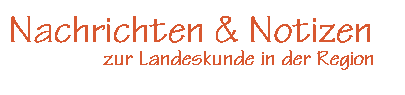
2/00
Raubgräber zerstören das archäologische Erbe
Ein Blick in die Presse offenbart die Brisanz des Themas:
Nach einem Artikel in der „Polizei-Zeitung Baden-Württemberg" von 1982 wurden bis dahin bereits rund ein Drittel der 8000 Grabhügel im Land angegraben.
Die spätkeltische Viereckschanze von Oberframmering (Landkreis Dingolfing-Landau) wurde 1995 und 1997 nach einer kombinierten Auswertung von Luftbild und magnetischer Prospektion publiziert, wobei die frühmittelalterliche Bestattung im Innern nur kurz erwähnt wurde. Genau sie wurde im Frühsommer 1997 planmäßig durch Raubgräber zerstört. Sie legten im Schutz der reifenden Gerste zwei parallele Gruben von 1,60 m Tiefe an und ließen nur zwei unvollständige Skelette und eine kleine Glasperle des 7. Jahrhunderts zurück.

Das Handelsblatt vom 27.5.98 zitiert Daniel Graepler vom Archäologischen Institut der Uni Heidelberg: „Ich kann mich nicht erinnern, daß es härtere Strafen für ertappte Grabräuber gegeben hat, höchstens mal eine Geldstrafe". Angesichts mancherorts operierender krimineller Banden eine Strafe, die bei den großen Gewinnen mit einem Schulterzucken weggesteckt wird. Auch Beschlagnahmung der Stücke hilft nicht weiter, da sowohl der Fundzusammenhang als auch die Ungestörtheit der Fundstätte selbst unwiederbringlich verloren sind. Graepler dazu: „Archäologische Fundstätten wachsen nicht nach."
So ging es auch fünf Hügelgräbern im hessischen Main-Kinzig-Kreis, die ausgegraben und zerstört wurden. Im Schutt fanden sich zertrümmerte vorgeschichtliche Keramikgefäße, weil es den Raubgräbern nur um Metallgegenstände ging, die sich teuer verkaufen ließen.
Und auch das Heidetränk-Oppidum bei Oberursel, das bedeutendste Bodendenkmal im hessischen Hochtaunuskreis, ist Ziel der Raubgräber. „Vor jedem dritten Baum klafft ein Loch im Waldboden", so der Bericht der Frankfurter Rundschau, und „Bei gutem Wetter stehen sie da zu Dutzenden und graben".
Nachdem allerdings die „großen" Funde aus der römischen Zeit allmählich weniger werden, verlagert sich der Schwerpunkt der kriminellen Suche: Auf das Mittelalter und in den Osten.
Bezirksgruppe Bergstraße - Neckartal (Heidelberg)