Die frühe Eisenzeit zwischen
Schwarzwald und Vogesen - Le premier âge du Fer entre la
Forêt-Noir et les Vosges.
Zusammengestellt von Andrea Bräuning, Wolfgang Löhlein
und Suzanne Plouin.
Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg Band
Nr. 66
Freiburg 2012. 288 S. mit zahlreichen, meist farbigen Abbildungen
Bezug über: Gesellschaft für Archäologie in Baden-Württemberg
und Hohenzollern, Berliner Str. 12, 73728 Esslingen a. N.
ISBN 978-3-942227-10-0 12,80 EUR
|
Die frühe Eisenzeit zwischen Schwarzwald und Vogesen -
Le Premier âge du Fer entre la Forêt-Noire et les
Vosges
Baden-Württemberg hat 2012 zum Keltenjahr erklärt.
Höhepunkt ist die Mitte September in Stuttgart eröffnete
große Landesausstellung mit herausragenden Exponaten aus
ganz Europa.
 Die Archäologen der Denkmalpflege in Freiburg haben aus
diesem Anlass zusammen mit elsässischen Forschern aus Museen,
Denkmalpflege und Universität ein Buch über die frühe
Eisenzeit (8.-4- Jh. v. Chr.) beiderseits des Rheins erstellt,
das sein Augenmerk auf die Landschaft zwischen Schwarzwald und
Vogesen richtet. Die grenzüberschreitende Kooperation trägt
den prähistorischen Verhältnissen Rechnung, denn der
Rhein bildete zu dieser Zeit weder eine kulturelle, noch eine
politische Grenze. Die Archäologen der Denkmalpflege in Freiburg haben aus
diesem Anlass zusammen mit elsässischen Forschern aus Museen,
Denkmalpflege und Universität ein Buch über die frühe
Eisenzeit (8.-4- Jh. v. Chr.) beiderseits des Rheins erstellt,
das sein Augenmerk auf die Landschaft zwischen Schwarzwald und
Vogesen richtet. Die grenzüberschreitende Kooperation trägt
den prähistorischen Verhältnissen Rechnung, denn der
Rhein bildete zu dieser Zeit weder eine kulturelle, noch eine
politische Grenze. Die zweisprachig aufgebaute Publikation stellt denn auch im
deutschen, wie im französischen Teil die Entwicklung des
eisenzeitlichen Siedlungswesens und der religiösen Äußerungen
vor - jeweils mit den eigenen Besonderheiten, die von Beginn
der archäologischen Forschungen an auch dem Finderglück,
den Interessensschwerpunkten von Forscherpersönlichkeiten,
oder den finanziellen Mitteln der Altertumsforscher geschuldet
waren. Doch ungeachtet der wechselnden Verhältnisse kann
heute ein dichtes und vielgestaltiges Bild dieser faszinierenden
Epoche gezeichnet werden.
Zunächst wurzeln die Traditionen der in Hofgemeinschaften
lebenden Menschen noch stark in den Traditionen der vorangehenden
Bronzezeit. So spielt das neue Metall, das Eisen, für die
Herstellung von Geräten, Werkzeugen und Waffen gegenüber
der Bronzetechnologie erst nur eine untergeordnete Rolle. Auch
im Grabbrauch werden die Bestattungssitten der Vorfahren beibehalten.
Die Toten wurden verbrannt und in Einzelgräbern unter Grabhügeln
bestattet. Einige Männergräber sind mit Schwertern
ausgestattet, dem Statussymbol der Hofherren oder Clanchefs.
Ganz überwiegend aber bestehen die Grabausstattungen der
Toten beiderlei Geschlechts aus Keramikgefäßen, die
als Behältnisse für Speisen und Getränke in reicher
Zahl in die Gräber gegeben wurden.
Die vorherrschende Wirtschaftsform der frühen Eisenzeit
war die Landwirtschaft.
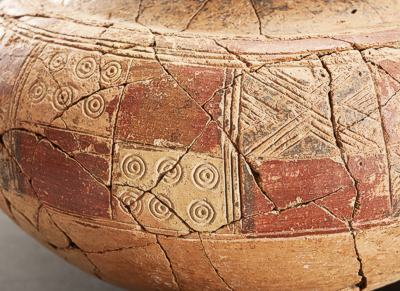
Reich verziertes Keramikgefäüß der frühen
Eisenzeit. Bild Regierungspräsidium Freiburg, Archäologische
Denkmalpflege. Foto Ben Wiesenfarth.
Zu Beginn des 6. Jh. v. Chr. entstehen infolge von Kontakten
zu den mediterranen Hochkulturen Siedlungszentren an wichtigen
Verkehrsrouten. Diese liegen meist, wie der Britzgyberg bei Illfurth,
oder der Breisacher Münsterberg, auf beherrschenden Höhen
und sind befestigt. Ihre Bewohner werden Schiffe - denn der Handel
erfolgte auf dem Wasserweg - durch schwierige Flussabschnitte
geleitet, Zölle erhoben und die Verteilung der Waren in
das Hinterland organisiert haben. Damit brachte es die lokale
Aristokratie zu teilweise erheblichem Reichtum, der sich in den
Gräbern in kostbaren Importen und goldenen Preziosen niederschlägt.
Gegenüber den vorangegangenen Jahrhunderten beginnen sich
auch die Bestattungsbräuche zu ändern. Von Westen her
breitet sich die Körpergrabsitte aus. Nur noch wenige Personengruppen
halten - vermutlich aus religiösen Gründen - am Brandgrab
fest. Allgemein werden die Beigaben gegenüber der Frühzeit
reichhaltiger. Allen gemeinsam bleibt, dass die Ahnenverehrung
eine zentrale Rolle im Grabbrauch spielt. Im Mittelpunkt steht
dabei der Hügel als Grabmonument. Häufig werden in
bereits bestehende Grabhügel neue Gräber eingebracht,
wodurch ein Bezug zur Erstbestattung des Hügels manifest
wird und familiäre oder soziale Bindungen ihren sichtbaren
Ausdruck finden. Bisweilen erfahren die Grabmonumente im Zuge
solcher Neubelegungen einen Ausbau und es entstehen Grabmale
von beeindruckenden Dimensionen. Zu den größten Grabhügeln
der Zeit gehören der ‚Magdalenenberg’ bei Villingen
oder das ‚Bürgle’ bei March-Buchheim mit Durchmessern
von rund 100 m.

Die hervorgehobene Bedeutung der früheisenzeitlichen Zentralorte
beruhte auf dem Ansehen und der Vormachtstellung einzelner Familien
oder Clans. Die Prachtentfaltung als Ausdruck ihres politischen
und wirtschaftlichen Erfolgs scheint jedoch in der Regel nur
wenige Generationen lang angedauert zu haben. Heute entsteht
der Eindruck, dass sie es nicht vermochten, familienunabhängige
Strukturen zu schaffen, die es erlaubt hätten die Herrschaft
zu institutionalisieren und damit auf Dauer zu festigen.
Die Blüte der politischen und wirtschaftlichen Zentren
endet im 4. Jh. v. Chr. Die Siedlungen werden aufgelassen, die
Friedhöfe nicht weiter belegt und viele der Prunkgräber
ausgeraubt. Die neuen Machtzentren finden sich nun in anderen
Landstrichen, wie Lothringen, der Rheinpfalz, dem
Hunsrück-Eifel-Gebiet oder in der Champagne.
Bild unten: Bronzearmspangen aus Bad Krozingen-Schlatt. Bild
Regierungspräsidium
Freiburg, Archäologische Denkmalpflege. Foto Ben Wiesenfarth. |