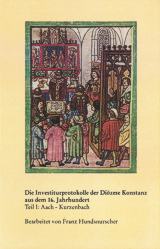Die Investiturprotokolle der Diözese
Konstanz aus dem 16. Jahrhundert. Teil I und II bearbeitet von Franz
Hundsnurseher, Redaktion Dagmar Kraus; Teil III. bearbeitet von Dagmar
Kraus. Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg,
Reihe A Quellen; Band 48/1, 48/11 und 49. W. Kohlhammer Verlag 2008-2010.
1937 S, Bd. 1 und 2 je 45,-Euro, Bd. 3 60,- Euro.
ISBN 978-3-17-020795-0, 987-17.020796-7 und 978-3-17-020797-4.
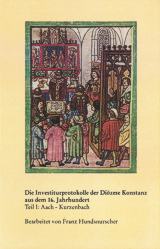
|
|
Das archivalische Erbe des 1821 aufgelösten Bistums Konstanz
wird zu einem Großteil im Erzbischöflichen Archiv
Freiburg bewahrt und betreut. Der langjährige Leiter des
Archivs, Dr. Franz Hundsnurscher (gest. am 18.11.2007), hat in
akribischer Detailarbeit die im Original überlieferten Investiturprotokolle
erfasst und in Form von Regesten systematisch für den Druck
aufgearbeitet. Sein in 22 Leitzordnern hinterlassenes Schreibmaschinenmanuskript
hat Frau Dagmar Kraus im Auftrag der Kommission für geschichtliche
Landeskunde redigiert und sodann mit der Erstellung eines gewaltigen
Orts-, Personen und Sach-Registerbandes für die Forschung
erschlossen. Die Bände schließen unmittelbar an die
von Manfred Krebs in der Zeitschrift »Freiburger Diözesanarchiv« Bd.
66 ff., 1938 ff. edierten Investiturprotokolle der Diözese
Konstanz aus dem 15. Jahrhundert.
Was für Informationen sind den Investiturprotokollen zu
entnehmen? Es handelt sich um einen einzigartigen Quellenbestand,
denn hier finden sich nahezu sämtliche Namen der Geistlichen
der Diözese Konstanz, die auf eine Pfründe eingewiesen
wurden oder durch Tod oder Verzicht daraus ausschieden, ferner
die Beurlaubungen und Vertretungen, die Inhaber des Pfarrpatronats
- und alles mit genauen Datierungen und mit der konkreten Bezeichnung
der Pfründe. Damit enthalten die Protokolle zentrale Inhalte
der in der Regel verlorenen Urkunden, die sich mit den entsprechenden
Vorgängen befasst hatten.
Der hier in vorbildlicher Weise zugänglich gemachte Quellenbestand
ist in vielfältiger Weise nutzbar: insbesondere für
Fragen der Kirchen-, Frömmigkeits-, Rechts- und Sozialgeschichte,
wie dies der Vorsitzende der Kommission für geschichtliche
Landeskunde im Geleitwort deutlich macht. Ausführlich geht
Dagmar Kraus in ihrer Einführung in das Werk (Bd. III, S.
1095-1133) auf die diversen Aspekte ein, die in der Publikation
zum Tragen kommen.
Die Protokolle bieten Material für eine Fülle von biographischen
und familiengeschichtlichen Forschungen. Vor allem aber erlauben
sie eine Analyse des katholischen Klerikerstandes in der Zeit
vor und nach der Reformation (u. a. in Bezug auf Herkunft und
Bildungsstand der Geistlichen, aber auch hinsichtlich der Art
der Pfründen oder die für die einzelnen Kirchen und
Altäre bestehenden Patrozinien). Für orts- und regionalgeschichtliche
Arbeiten wird das Werk künftig unverzichtbar sein.
Wolfgang Hug
|
|
2/2011
|
|