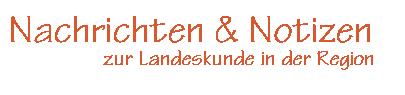
3-4/00
Die Ästhetik des Krieges ? - Kurpfalz im Rheinland
Im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprojekt "Der Riss im Himmel" wird in der Ausstellung des Museums Zitadelle und zahlreichen Veranstaltungen die historische Kulisse der kurpfälzischen Festungsstadt Jülich bis zum 1. Oktober zur eindrucksvollen Bühne für Inszenierungen einer längst vergangenen Zeit.
Über zwei Jahrhunderte lang prägte Militär die Stadt und das Stadtbild. So wird die Jülicher Zitadelle, ein bedeutendes und in ihrem Erhaltungszustand einmaliges Festungsbauwerk aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert, zur authentischen Kulisse für die Fragen zum Wesen und Stellenwert des Militärs.
An Militärakademien erlernten die Adeligen die Wissenschaft des Krieges. Nach mathematischen Regeln galt es Schlachtpläne, Befestigungswerke und Belagerungen zu entwerfen und durchzuführen. Die Offiziere sollten durch diese Kunst den Krieg kalkulierbar machen. Diese Berechenbarkeit war allerdings nur durch Disziplin und absoluten Gehorsam der Soldaten möglich. Sie mußten sowohl beim Marschieren, als auch beim Schießen auf Befehl absolut synchron handeln. Durch diesen Drill wurde der einfache Soldat zu einem Teil der Kriegsmaschinerie, der er willenlos ausgeliefert war. Ebenso wie die Zivilisten, die damals wie heute die eigentlichen Leidtragenden eines jeden Krieges sind. Sie durchleben mit Plünderung, Belagerung, Raub, Mord und Vergewaltigung das Elend eines Krieges.
Kurpfälzischer Offizier, Stadtgeschichtliches Museum Jülich
Zu Beginn wird der Besucher in Welt des Soldaten geführt. Nach dem disziplinarischen Debakel des dreißigjährigen Krieges mit seinen marodierenden Söldnerhaufen wurde das Heerwesen grundlegend reformiert. Mit der Einrichtung ständig unter Waffen stehender Heere entstand der Berufsstand Soldat, dessen Alltag nicht vom Kampfeinsatz, sondern von der Ausbildung geprägt war. Neue Militärtaktiken verlangten nicht mehr nach individueller Tapferkeit sondern nach funktionierenden Gliedern einer Kriegsmaschinerie, die vom Feldherren gesteuert wurde. Durch harten Drill synchronisierte Bewegungsabläufe sollten die Schußfolge optimieren und normierte Gefechtsformationen schaffen. Drill und Disziplinierung sind darum auch Schwerpunkte der Ausstellung. Exerzierregelements, Uniformierung und Strafmaßnahmen führen die Auffassung vom Soldaten als Teil einer Maschine vor Augen.
Die Einführung der stehenden Heere veränderte auch das Stadtbild. Kasernen, Drill- und Paradeplätze wurden angelegt, strategisch wichtige Städte und Plätze entlang von Versorgungswegen wurden befestigt. Der Ausbau der Festungen wird anhand der damals kurpfälzischen Städte Jülich und Düsseldorf gezeigt. Auffallend sind die an strengen geometrischen Formen orientierten Grundrisse. Dies war keine architektonische Spielerei, von der Geometrie erhoffte man sich eine Berechenbarkeit und damit eine Beherrschbarkeit militärischer Funktionen. Geometrische Formen spiegelten sich in der Welt des Adels überall wider, nicht nur in der Kriegführung, sondern auch in Bauwerken, Gärten, Tänzen und Pferdedressuren.
Die wird vor allem im Ausstellungsteil zum Lebensumfeld des Offiziers deutlich. Der Offizier erlernte in neu eingerichteten Militärakademien die Wissenschaft vom Kriege, die damals zu den Künsten zählte. Die dort gelehrten militärischen Theorien wurden bestimmt vom Denken in geometrischen Beziehungen. Schlachtpläne, Befestigungswerke und Belagerungen wurden nach mathematisch-geometrischen Regeln entworfen und ausgeführt.
Die Erfahrungen und Schrecken des Krieges entziehen sich jedoch einer angemessenen Vermittlung. Die Ausstellung will das ästhetische Empfinden durchbrechen, das die Welt des Adels prägte und bis heute das Bild frühneuzeitlicher Kriege - mit Ausnahme der Dreißigjährigen - mitbestimmt. Historische Schlachtdarstellungen und erhaltene Festungsarchitektur üben auch heute noch eine Faszination auf den Betrachter aus, die es kritisch zu hinterfragen gilt.
Der dritte Teil durchbricht daher mit Inszenierungen zur Kriegswirklichkeit diese wissenschaftlich-nüchterne Betrachtung des Krieges. Krieg war und ist, allen Bemühungen um eine vernünftige und emotionsfreie Betrachtungsweise zum Trotz, grausam und mit Leid und Elend für die Betroffenen verbunden. Sei es der Soldat, der als willenloser Teil eines Schlachtplans auch in auswegloser Situation auszuharren hatte, seinen es Zivilisten, die durch Belagerung, Plünderung, Raub, Mord und Vergewaltigung die eigentlichen Leidtragenden von Kriegen waren und sind.
Christoph Fischer, Stadtgeschichtliches Museum Jülich
Bezirksgruppe Bergstraße - Neckartal (Heidelberg)