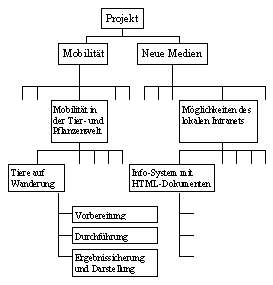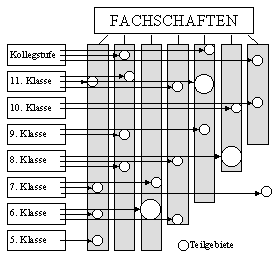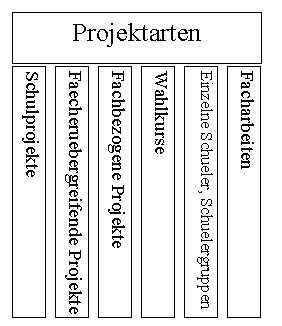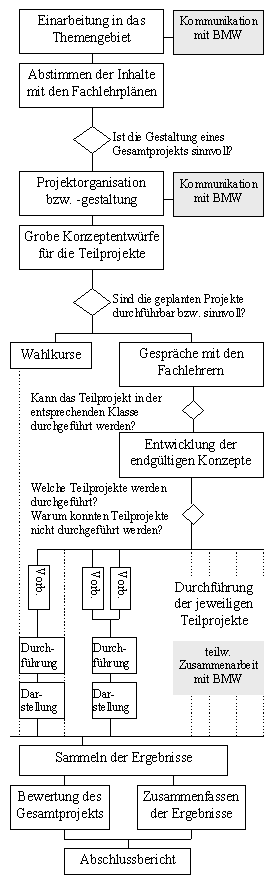Historie
Das Thema „Mobilität“ bewegt den Menschen, seit
er auf dieser Erde umhergeht. In der Vergangenheit war die wachsende Mobilität
eng verknüpft mit dem wachsenden Wohlstand des Menschen.
 Inzwischen fühlen sich aber immer mehr Menschen von der wachsenden Mobilität
eingeschränkt. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieses Thema in unserer
Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass
jeder mit diesem Thema seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, also jeder ein
kleiner Experte auf diesem Gebiet ist. Diese vielen unterschiedlichen Sichtweisen
machen die Komplexität dieses Themengebiets aus. Um Lösungen für zukünftige
Probleme der wachsenden Mobilität zu finden, bedarf es mehrerer Sichtweisen.
Inzwischen fühlen sich aber immer mehr Menschen von der wachsenden Mobilität
eingeschränkt. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieses Thema in unserer
Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass
jeder mit diesem Thema seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, also jeder ein
kleiner Experte auf diesem Gebiet ist. Diese vielen unterschiedlichen Sichtweisen
machen die Komplexität dieses Themengebiets aus. Um Lösungen für zukünftige
Probleme der wachsenden Mobilität zu finden, bedarf es mehrerer Sichtweisen.
Mobilität ist Leben
Mobilität ist Freiheit
Mobilität ist Wohlstand
Mobilität ist Zukunft
Thesen von Dr. Frank (BMW AG)
Das Thema eignet sich besonders gut für ein Projekt
an der Schule. Es umfasst in besonderer Weise physikalische, technische und
geschichtliche Inhalte, die untrennbar mit der Freiheit und Verantwortlichkeit
der Menschen verbunden sind.
 Unser tägliches Leben ist geprägt von unaufhaltsamen Globalisierungsprozessen.
Die damit verbundenen Problemfelder sollen ebenso dargestellt und analysiert
werden wie die Bedeutung von Erkenntnissen und Ergebnissen aus Wissenschaft,
Forschung und Technik in den Bereichen Naturwissenschaft und Geschichte. Vor
allem soll ein Fragebewusstsein herausgearbeitet werden, auf welcher Grundlage
die Lösung von Problemen zur Entwicklung der Gesellschaft, aber auch zu schicksalhaften
Entscheidungen geführt haben.
Unser tägliches Leben ist geprägt von unaufhaltsamen Globalisierungsprozessen.
Die damit verbundenen Problemfelder sollen ebenso dargestellt und analysiert
werden wie die Bedeutung von Erkenntnissen und Ergebnissen aus Wissenschaft,
Forschung und Technik in den Bereichen Naturwissenschaft und Geschichte. Vor
allem soll ein Fragebewusstsein herausgearbeitet werden, auf welcher Grundlage
die Lösung von Problemen zur Entwicklung der Gesellschaft, aber auch zu schicksalhaften
Entscheidungen geführt haben.
Begreift man heute Mobilität, so geht es nicht nur
um die räumliche Mobilität für den Einzelnen oder für Erzeugnisse, sondern auch
um räumliche und zeitliche Mobilität für Informationen. Kann mit den sogenannten
„Neuen Medien“ physische Mobilität ersetzt werden? Oder erzeugen sie zusätzliche
Mobilität?
Die bisherigen Erfahrungen in der Schule lehren,
dass die „Neuen Medien“ zu Änderungen in den bestehenden Strukturen führen.
Als Beispiel sei nur die Lehrerrolle genannt. Das Informationsangebot ist inzwischen
so reichhaltig, dass in Zukunft Lehrer verstärkt Aufgaben des Wissensmanagement
wahrnehmen müssen, z.B. den Schülern geeignete Methoden vermitteln, wie sie
Informationen erhalten, verarbeiten und in Wissen umsetzen können. Wissensmanagement
wird zu einem zentralen Anliegen künftiger Schulentwicklung.
Projekt
In diesem Abschnitt wird das Gesamtprojekt unter
organisatorischen Gesichtspunkte beschrieben.
Projektziele
| |
|
|
| |
Bearbeitung des Themengebiets „Mobilität“ in einem
fächerübergreifenden Schulprojekt.
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Verbesserung der Nutzung neuer Medien und Technologien
zum Sammeln und Austauschen von Informationen.
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Überprüfung der Übertragbarkeit von modernen Arbeitsmethoden
der Wirtschaft in den Schulbereich.
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Förderung des Expertenwissens innerhalb des Lehrerkollegiums
durch Fortbildungen und Kooperationen.
|
|
| |
|
|
- Durch eine Internetdarstellung soll die Öffentlichkeit
für die Thematik sensibilisiert werden.
- Mit Hilfe der unterschiedlichen Methoden
mit neuen Medien sollen effiziente Wege für eine Unterrichtsgestaltung erprobt
werden.
- Außerdem wird untersucht, wie man mit der
Zusammenarbeit von Schule, Arbeitswelt und Wissenschaft den Unterricht praxisorientierter
gestalten kann.
Projektorganisation
Aufbau
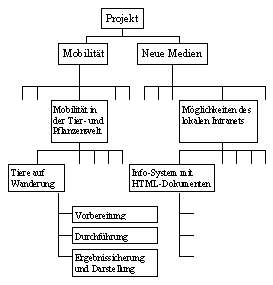
Betrachtet man den Aufbau des Projekts findet man
die folgende Situation vor. Die einzelnen Teilgebiete, die in das übergeordnete
Themengebiet passen, sind über unterschiedliche Fachgebiete und Klassenstufen
verstreut.
Außerdem sind sie vom Umfang sehr unterschiedlich
und lassen sich oft nicht eindeutig einem Fachgebiet zuordnen.
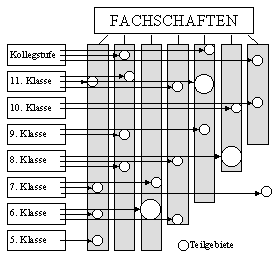
Deswegen wurden die einzelnen Themen in unterschiedliche
Umgebungen eingebunden. Themen, die mit dem Lehrplan vereinbar waren, wurden
im regulären Unterricht bearbeitet. Dabei wurden sie je nach Art in fachbezogenen
oder in fächerübergreifenden Projekten behandelt.
Die Einbindung der „Neuen Medien“ wurde sowohl in
Wahlkursen am Nachmittag als auch im regulären Unterricht erprobt. Der Vorteil
bei Wahlkursen bestand darin, dass kleinere, übersichtlichere Kurse gestaltet
werden konnten. Ferner konnten hier Themen behandelt werden, die nur am Rande
in den Lehrplan passen. Vertiefende und speziellere Themen wurden von interessierten
Schülern alleine oder in kleineren Gruppen mit der Unterstützung des jeweiligen
Fachlehrers bearbeitet.
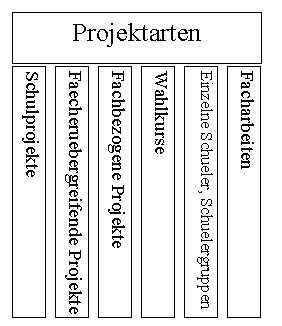
Bei fächerübergreifenden Projekten ist es üblich,
dass die betroffenen Fachgebiete gemeinsam (in der selben Klasse, zeitgleich)
das Projekt gestalten. Leider war dies nicht immer möglich. Manchmal wurden
in einem fächerübergreifenden Projekt die Themen zwar in unterschiedlichen Fachgebieten
behandelt, aber in verschiedenen Klassenstufen oder zu unterschiedlichen Zeiten.
Wie der Informationsaustausch und die Ergebnissicherung
in der Zukunft aussehen, wurde in den Schulprojekten „Wissensmanagement an Schulen
und Schulentwicklung“ und "MINT-EC (Math. nat. Excellence Center an Schulen)"
getestet. Insbesondere wurde untersucht, wie man mit neuen Medien Nachhaltigkeit
erzielen kann. Dabei wurden auch Fortbildungen für Lehrer integriert.
Schulprojekte
Betreuung: Lehrerteam
§
Wissensmanagement
§
MINT-EC
§
Fortbildungen für Lehrer (z.B. MNU-Tagung)
Fächerübergreifende Projekte:
Betreuung: Lehrer im regulären Unterricht (Gruppenarbeit)
§
Verkehr in Ballungsräumen
§
Energietechnologien im Vergleich
§
Medienerziehung, z.B. Grundlagen Netze
Fachbezogene Projekte
Betreuung: Lehrer im regulären Unterricht (Gruppen- / Freiarbeit)
§ Mobilität
in der Tierwelt (Biologie)
§
Reisen in verschiedenen Epochen (Geschichte)
§
Kanada Projekt „Youthlinks“ (Englisch)
§ Kurz-schneller-am
billigsten (Mathematik)
§
Medienerziehung, z.B. Grundlagen Netze (Informatik)
Wahlkurse/Wahlpflichtkurse
Betreuung: Fachlehrer (Partner- und Gruppenarbeit)
§
Autorensysteme und Elektronisches Schulbuch
§
Luft- und Schienenfahrzeuge
§
Kommunikation und Möglichkeiten des Internet
Kleine Schülergruppen
Betreuung: Fachlehrer (Selbständiges Experimentieren)
§
Experimentalvorträge von Schülern (Tag der Chemie)
§
Der Wettlauf zum Mond
§
Weltraumvisionen zum Nutzen der Menschheit
Facharbeiten einzelner Schüler
Betreuung: Fachlehrer (Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten)
§
Navigation mit Sextant und GPS (Mathematik)
§
Biologische Wasserstoffproduktion (Biologie)
Projektablauf
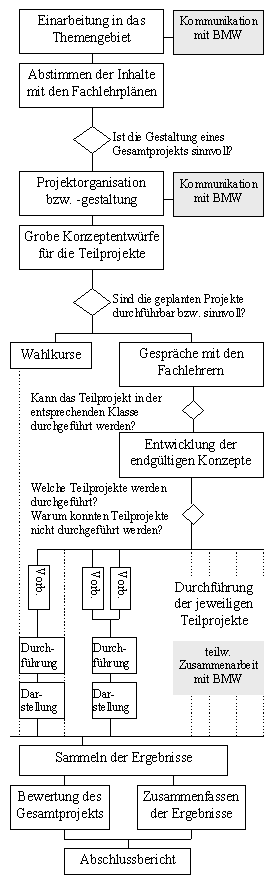
Vorbereitungsphase:
Die Vorbereitungsphase begann schon während der
Ferien. Zuerst musste man in den einzelnen Fachlehrplänen Themen suchen, die
sich in das Projekt einbinden lassen. Damit man die ersten Gespräche mit den
jeweiligen Fachlehrern führen konnte, musste man sich grob in die einzelnen
Themengebiete einarbeiten. Eine Schwierigkeit ergab sich daraus, dass man in
einem fremden Fachgebiet oft nicht genau weiß, ob und wie man ein bestimmtes
Thema mit der Rahmenbedingung „Lehrplan“ in Einklang bringen kann.
In der Vorbereitungsphase hat sich die enge Zusammenarbeit
mit BMW als sehr nützlich erwiesen. So wurden einige interessante Themen und
Inhalte übernommen. Auch bei der Projektorganisation war die Unterstützung sehr
hilfreich.
Zu Beginn des Schuljahrs musste man mit den einzelnen
Lehrern der jeweiligen Klassen, in denen man ein Projekt geplant hatte, erste
Vorbesprechungen führen. Dabei wurde u.a. die Durchführbarkeit überprüft und
der zeitliche Rahmen festgelegt.
Um spezielle Themen des Projekts zu behandeln, wurden
geeignete Wahlkurse eingerichtet. Diese Kurse wurden so gestaltet, dass die
gewählten Methoden und Themen noch in einem regulären Unterricht behandelt werden
konnten. So wurden in diesen Kursen Unterrichtsmethoden und Arbeitsmaterialien
getestet und verbessert.
Nach den ersten Vorgesprächen mit den Kollegen aus
den unterschiedlichen Fachgebieten koordinierte der Projektleiter, welche Themen
in den einzelnen Fächern und Klassenstufen bearbeitet wurden. Er besprach mit
den Lehrern die ausgearbeiteten Konzepte für die einzelnen Teilprojekte. Es
musste festgestellt werden, in wie weit der Projektleiter den jeweiligen Fachlehrer
unterstützen konnte (z.B. "Neue Medien", Beschaffung von Informationsmaterial,
Kontakte zu außerschulischen Einrichtungen,...). Die einzelnen Teilprojekte
wurden dann endgültig von den Fachlehrern einzeln oder im Team vorbereitet.
Bei fächerübergreifenden Projekten besprachen die beteiligten Fachlehrer die
gemeinsame Vorgehensweise.
Durchführung und
Darstellung der Teilprojekte:
Die Teilprojekte wurden von den jeweiligen Fachlehrern
mit Schülergruppen durchgeführt. Die meisten Themen wurden mit Hilfe der neuen
Medien bearbeitet. Dabei unterstützte der Projektleiter die Fachlehrer. Hier
hat sich gezeigt, dass es vorteilhaft war, wenn zusätzlich eine Fachkraft mit
guten Computerkenntnissen zur Verfügung stand. Sie konnte einerseits in Computerraum
anwesend sein um einzelnen Schülern oder Schülergruppen bei der Recherche im
Internet hilfreich zur Seite zu stehen. Andererseits konnte sie den Lehrer im
Unterricht im Computerraum unterstützen.
Die Schüler bearbeiteten selbständig die einzelnen
Themen. Besuche von außerschulischen Einrichtungen z.B. die Ausstellungen "Clean
Energy" von BMW oder "Move on!" im Siemensforum wurden bei einzelnen
Teilprojekten ergänzend durchgeführt. Die Schüler präsentierten ihre Ergebnisse
u.a. mit Plakaten, Referaten, HTML-Dokumenten und Modellen. Auch der Nachweis
des Kenntnisstandes in schriftlichen Tests wurde teilweise verlangt.
Plakate eigneten sich für Teilprojekte, die zeitlich
eher begrenzt waren und nur in der Schule präsentiert wurden. Bei einem größeren
Projekt wurde die Ausarbeitung mit HTML-Dokumenten gestaltet. (Siehe Intra-
und Internet)
Die unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten belebten
das Projekt. Einige Schüler waren zusätzlich motiviert, als sie z.B. ein Modell
zu ihrem Thema bastelten. Eine Möglichkeit, dass der Informationsaustausch zwischen
den Schülern und die Überprüfung der Eigenleistung gewährleistet wurde, waren
kleine Vorträge am Ende des Projekts. Ein Referat wurde bei einem kleineren
Themengebiet, das nur von einem Schüler oder einer einzelnen Schülergruppe bearbeitet
wurde, als Darstellungsart gewählt. Zum Teil wurden die einzelnen Teilprojekte
nach der Beendigung der Schulöffentlichkeit vorgeführt.
 zurück zur Hauptseite
zurück zur Hauptseite
 Inzwischen fühlen sich aber immer mehr Menschen von der wachsenden Mobilität
eingeschränkt. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieses Thema in unserer
Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass
jeder mit diesem Thema seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, also jeder ein
kleiner Experte auf diesem Gebiet ist. Diese vielen unterschiedlichen Sichtweisen
machen die Komplexität dieses Themengebiets aus. Um Lösungen für zukünftige
Probleme der wachsenden Mobilität zu finden, bedarf es mehrerer Sichtweisen.
Inzwischen fühlen sich aber immer mehr Menschen von der wachsenden Mobilität
eingeschränkt. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieses Thema in unserer
Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass
jeder mit diesem Thema seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, also jeder ein
kleiner Experte auf diesem Gebiet ist. Diese vielen unterschiedlichen Sichtweisen
machen die Komplexität dieses Themengebiets aus. Um Lösungen für zukünftige
Probleme der wachsenden Mobilität zu finden, bedarf es mehrerer Sichtweisen. Unser tägliches Leben ist geprägt von unaufhaltsamen Globalisierungsprozessen.
Die damit verbundenen Problemfelder sollen ebenso dargestellt und analysiert
werden wie die Bedeutung von Erkenntnissen und Ergebnissen aus Wissenschaft,
Forschung und Technik in den Bereichen Naturwissenschaft und Geschichte. Vor
allem soll ein Fragebewusstsein herausgearbeitet werden, auf welcher Grundlage
die Lösung von Problemen zur Entwicklung der Gesellschaft, aber auch zu schicksalhaften
Entscheidungen geführt haben.
Unser tägliches Leben ist geprägt von unaufhaltsamen Globalisierungsprozessen.
Die damit verbundenen Problemfelder sollen ebenso dargestellt und analysiert
werden wie die Bedeutung von Erkenntnissen und Ergebnissen aus Wissenschaft,
Forschung und Technik in den Bereichen Naturwissenschaft und Geschichte. Vor
allem soll ein Fragebewusstsein herausgearbeitet werden, auf welcher Grundlage
die Lösung von Problemen zur Entwicklung der Gesellschaft, aber auch zu schicksalhaften
Entscheidungen geführt haben.