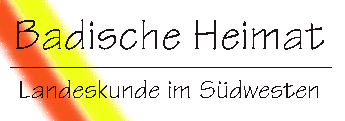
Schwerpunktthema
Heidelberg
1996 ein Jubeljahr für Heidelberg (?)
N&N 3/95
1196. Heinrich, Pfalzgraf (comes palatinus reni), beurkundet, daß sein Schwiegervater (socer) Konrad, comes palatinus reni, und dessen Gemahlin Hirmengardis, der Kirche der seligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria in Schönau (Schonaugia), wo beide ihre Grablege erbeten und erwählt hatten, ein Gut in Oppau (Opphauue) mit allen Rechten geschenkt habe. Die ersten Erträge aus diesem Gut sollten zum Bau des Kapitels der genannten Kirche dienen. Darüberhinaus habe er allen Bewohnern seines Machtbereiches (sue ditionis) erlaubt, sich oder etwas aus ihrem beweglichen oder unbeweglichen Besitz der Kirche zu eigen zu geben. Er habe auch festgelegt, daß aus den Erträgen jenes Besitzes zwei Jahrzeiten zu seinem und seiner Frau Gedächtnis gefeiert werden sollten. Nach seinem Tod habe seine Gemahlin die dem Gut benachbarten Rheininseln zu seinem und ihrem Seelenheil dem Kloster geschenkt, aus ihrem Ertrag sollen die Lichter für den Michaels und den Nikolausaltar besorgt werden. Seine Schwester Liutgard habe der Küsterei (custodia) der genannten Kirche einen Weinberg im Wert von 20 Mark geschenkt, aus dem der Meßwein genommen werden solle.
Diese Schenkungen seines Schwiegervaters bestätigt Pfalzgraf Heinrich, auch für seine Gemahlin Agnes, und fügt hinzu, daß auch alle die, die sich künftig niederlassen werden, das Recht zur Hingabe an das Kloster haben sollten.
Siegelankündigung des Ausstellers.
Zeugen: die Äbte Sigehard von Lorsch, Meffrid von Eberbach, Diepold von Schönau, Propst Volkert von S. Cyriak, Notar Rudolf, Mönch von S. Ägidien, Pleban Konrad von Heidelberg, Notar Albert, die Pröpste Marquard von Neuburg und Helfrich von Lobenfeld, Pleban Heinrich von Bacharach, dann die Grafen Symon von Saarbrücken, Heinrich von Zweibrücken, Walrav von Nassau, Berthold von Ramsberg, Konrad von Eberbach, Boppo von Lauffen, schließlich Bligger von Steinach mit seinen Söhnen und andere.
1196, Indictione quintadecima.
Kop. Karlsruhe, GLA 67/1302; Kop. vid. (Kg. Ruprecht 1404) Luzern, StaatsA. GA 1013 (GattererApparat)
Die Aussagekraft dieser Urkunde ist, was Heidelberg angeht, relativ gering: Es gibt eine Siedlung Heidelberg, die eine Kirche mit einem Pleban hat. Die Kirche ist unzweifelhaft die Peterskirche, der Pleban (auf deutsch Leutpriester) ist der Seelsorger und Inhaber der Pfarrei. Wo diese Siedlung genau liegt, welchen Umfang sie hat, welche innere Struktur, welche Rechtsstellung das wird aus der Urkunde nicht deutlich.
Hier aber beginnt die Interpretation: Pleban Konrad und Pleban Heinrich von Bacharach sind die einzigen Priester, die hier auftreten, und der Priester von Bacharach kommt aus dem "ursprünglich" pfalzgräflichen Bereich. Beide dürften also zum pfalzgräflichen Gefolge gehören. Die Peterskirche geht mit ihrem PetersPatrozinium möglicherweise auf das Bistum Worms zurück, von dem der Pfalzgraf Heidelberg zu Lehen nimmt. Diese Kirche ist bereits von der Kirche in Bergheim getrennt, zu der der dazugehörige Ort möglicherweise einmal gehört hat. Das PetersPatrozinium aber ist auf jeden Fall früher entstanden als im 12. Jahrhundert, damit dürfte auch der Burgweiler "Ur-Heidelberg" auch zu dieser Zeit (1196) schon eine Weile bestanden haben vielleicht als Burgweiler einer Wormser Burg am Talausgang.
Das Patronatsrecht der Peterskirche (wie auch der Patronat der Bergheimer Pfarrkirche) wird von Pfalzgrafen im 14. Jahrhundert an das Kloster Schönau geschenkt offenbar galten beide als frei verfügbares Eigentum (Allodialgut). Das würde der Theorie vom Wormser Eigentum an Heidelberg widersprechen. Die Lösung könnte in einem Allodialbesitz des Pfalzgrafen, vielleicht als Rechtsnachfolger der Salier, am alten Burgweiler "Ur-Heidelberg" mitsamt dem Gelände am Talausgang (Bergheim) liegen. Dann müßte aber der Ursprung der Siedlung noch weiter hinaufgerückt werden etwa an den Ausgang des 11. Jahrhunderts. Den historischen Zusammenhang dazu gäbe die expansive Filiationspolitik des Klosters Lorsch mit seinen Tochterklöstern auf dem Heiligenberg und mit Neuburg (1130/1165), mit dem Lorsch bereits ins Neckartal vorgedrungen war.
Worms seinerseits schlägt einen "Nagel" ein, als es 1142 das Kloster Schönau gründet, und gleichzeitig werden die Herren von Steinach und Graf Boppo von Lauffen auf dem Dilsberg faßbar. Wer auch immer den Talausgang an der Peterskirche in der Hand hatte spätestens jetzt, 1142, war die Notwendigkeit da, hier Anwesenheit und politisches Durchsetzungsvermögen zu demonstrieren zum Beispiel mit der Gründung der Siedlung um die Peterskirche, zum Beispiel mit der Befestigung eines Burgplatzes.
Die Lehnspflicht wegen Stadt und Schloß Heidelberg gegenüber dem Bistum Worms könnte dann erst begründet worden sein, als vor 1225 der Pfalzgraf östlich des Burgweilers die Stadt Heidelberg gründete und wahrscheinlich das "Untere Schloß" dazu.
Fortsetzung: 1225