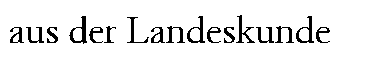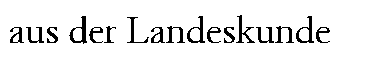|
15.8.07
Götterhimmel im Grünen
Eine fachkundige Sonderführung im Schlossgarten Weikersheim
vermittelte am vergangenen Sonntag ein wahrhaft gräfliches
Lebensgefühl und einen tiefen Einblick in die Allegorienwelt des
18. Jahrhunderts. „Lustwandeln wie ein Graf“ war als Thema
versprochen, doch wer glaubte, ihn erwarte ein gemütlicher
Spaziergang im Schlossgarten, der sah sich getäuscht. Denn
„Lustwandeln“ hieß für gräfliche Genießer zwar durchaus, sich im
Schatten der hohen Bäume zu ergehen, her aber andererseits, die
Allegorien und symbolischen Darstellungen im Garten zu erkennen,
aufzunehmen und als Regierungsprogramm des gräflichen Gastgebers
zu deuten.
So begann die Führung mit Anita Kessler auch stilecht beim
zuschauenden „Volk“, den auf der Balustrade des Gartens
aufgereihten Zwergenfiguren, die – vollständig erhalten wie sonst
kaum – zwischen 1710 und 1720 geschaffen den Hofstaat des Grafen
Carl Ludwig darstellen. Weil es Menschen waren, die dem Treiben
der Götter im Park zusehen durften, waren sie entsprechend klein
zu gestalten.

Dann tauchten die Teilnehmer ein in eine verwirrende Welt von
Allegorien und Göttern. Die vier Elemente bilden das Entrée des
Gartens, der seinerseits begrenzt wird von steil aufgerichteten
Personifikationen der vier Winde. Ihre hoch emporstrebende Flamme,
eine hohe Lohe, ist gleichzeitig eine Anspielung auf den Namen
Hohenlohe.
Bacchus, der Weingott, gab Anlass, über den Weinbau als eine
der Haupt-Einkommensquellen des Grafen Carl Ludwig zu berichten,
während Athene-Minerva gegenüber, nicht ganz nachvollziehbar, das
Kriegsglück des Schlossherrn symbolisieren sollte. Vielleicht
symbolisiert die geharnischte Göttin doch eher die fürstliche
Weisheit.
Zentrum des Parks bildet die Herkulesstatue. Auch sie hat, wie
so vieles im Barock, mehrere Bedeutungen. Einerseits ist Herkules
im „klassischen“ Bildprogramm die Personifikation der fürstlichen
Stärke – man denke nur an August den Starken in Sachsen –,
andererseits deutet dieser Herkules, wie er mannhaft den Drachen
Ladon besiegt, auf die goldenen Äpfel der Hesperiden, die dieser
bewachte, und die dann als Kübelpflanzen das Brunnenbassin
umstanden.
Ebenfalls um den zentralen Brunnen angeordnet sind die Statuen
der „Planetengötter“, wie man sie aus anderen Bildprogrammen
kennt. Weniger der astronomische Begriff der Planeten steht dabei
im Vordergrund, sondern ihre Zuordnung zu den Wochentagen: Saturn
für den Samstag, Apoll, der Sonnengott, für den Sonntag, Diana als
Mondgöttin für den Montag usw. Warum allerdings Neptun, der
Meeresgott, in dieser Reihe steht, kann wohl nur damit begründet
werden, dass die Siebenzahl der Wochentage nicht ausreichte, den
Kreis der Götterstatuen zu füllen.
Höhepunkt des Gartens ist dann die Orangerie. Sie bildet
gewissermaßen das Zentrum des äußeren Gartenteils, des
Orangeriegartens, der außerhalb des „inneren“, von den vier Winden
abgegrenzten Bereichs liegt. Die Orangerie war einerseits
repräsentativer Abschluss des Gartens, andererseits Sala Terrena
und Heimstatt für die Zitrusbäume während des langen Hohenloher
Winters. Sie wurde als Theaterkulisse gebaut, als Rahmen für das
majestätische Reiterstandbild des Schlossherren, das heute durch
eine andere allegorische Figur ersetzt ist. Diesen Rahmen
bildeten, und das versinnbildlicht den Geltungsanspruch des
Schlossherrn, die vier großen Könige des Altertums, die Herrscher
der vier großen Weltreiche: Nimrod von Assyrien, Kyros von
Persien, Alexander der Große und Augustus.
Kleinere Ungereimtheiten in den Ausführungen sollten der
durchaus kompetenten Führerin nicht angelastet werden. Sie
schaffte es, ein Bild von der vielfältigen Allegorienwelt des 18.
Jahrhunderts zu zeichnen, das den Zeitgenossen – die durchweg eine
„Kavalierstour“ zu ihrer eigenen Bildung unternommen hatten –
sofort bewusst war, kaum dass sie einen der vielen gedanklichen
Anknüpfungspunkte sahen. „Lustwandeln wie ein Graf“ war eben nicht
nur das stille Genießen, sondern das Erkennen der Bezüge, die der
Schloss- und Gartenherr zu seiner eigenen Selbstdarstellung
aufgebaut hatte. |