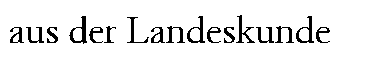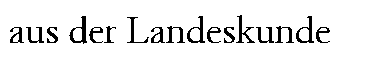|
14.8.08
Neuer Silbergrauer Führer für Schloss
Bruchsal
Nur 80 Jahre dauerte die glanzvolle Zeit des Bruchsaler Schlosses.
1802 gelangte die ab 1722 errichtete Residenz der Fürstbischöfe
von Speyer in den Besitz des Landes Baden. Nach 1832 verfiel die
Anlage zusehends und wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts wieder
als kunsthistorisch wertvolles Ensemble erkannt. Nach schweren
Zerstörungen in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs wurde
das Schloss in seinem äußeren Umriss und seinen Fassaden
wieder aufgebaut, der Mittelteil mit Treppenhaus und Festsälen
originalgetreu rekonstruiert.
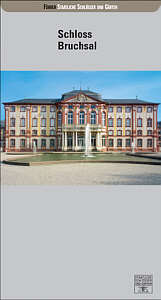 Balthasar
Neumanns berühmtes Treppenhaus, die Malereien der Erdgeschossräume,
aber auch Reste der barocken Gartenkonzeption zeugen von dem kenntnisreichen
Bauherrn Kardinal Damian Hugo von Schönborn, der in der Anlage
Einflüsse unterschiedlichster Herkunft verarbeiten ließ. Unter
seinem Nachfolger Franz Christoph von Hutten entstanden die prunkvollen
Rokokodekorationen der Festsäle und der heute verlorenen Appartements
der Beletage. Im Schlossgarten mit seinem reichen Baumbestand
haben auch das 19. und 20. Jahrhundert ihre Spuren hinterlassen. Balthasar
Neumanns berühmtes Treppenhaus, die Malereien der Erdgeschossräume,
aber auch Reste der barocken Gartenkonzeption zeugen von dem kenntnisreichen
Bauherrn Kardinal Damian Hugo von Schönborn, der in der Anlage
Einflüsse unterschiedlichster Herkunft verarbeiten ließ. Unter
seinem Nachfolger Franz Christoph von Hutten entstanden die prunkvollen
Rokokodekorationen der Festsäle und der heute verlorenen Appartements
der Beletage. Im Schlossgarten mit seinem reichen Baumbestand
haben auch das 19. und 20. Jahrhundert ihre Spuren hinterlassen.
Die Autorin Sandra Eberle, ehemals wissenschaftliche Volontärin
bei der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten,
jetzt freie Kunsthistorikerin, stellt zunächst die Baugeschichte
der Anlage dar, die ja bekanntlich vor allem dadurch geprägt
ist, dass der Bauherr, Damian Hugo von Schönborn, Fürstbischof
von Speyer, sich plötzlich entschloss, im bereits begonnenen
Corps de Logis ein Mezzaningeschoss einzufügen. Dass er damit
den gesamten Plan des Treppenhauses über den Haufen warf,
kümmerte ihn wenig. Balthasar Neumann, Hof- und Stararchitekt
der Schönborn, sprang ein und lieferte mit seinem Treppenhaus-Plan
den Entwurf, dessen Genialität angesichts der Leichtigkeit,
die er vermittelt, erst auf den zweiten Blick auffällt.
Auch der Nachfolger Bischof Schönborns, Franz von Hutten,
orientierte sich an der Kunstmetropole der Schönborns, an
Würzburg, von wo er ab 1751 die Künstler der Innenausstattung
holte. Sandra Eberles Ausführungen sind hier durchweg detailreich
und logisch, ohne jedoch zu trocken zu wirken.
Die Geschichte des Schlosses in badischem Besitz, von der Einrichtung
der Residenz für die Markgräfin Amalie von Baden, die
hier ihren Witwensitz bezog, bis zu Zerstörung und Wiederaufbau,
bildet das letzte Kapitel in der umfangreichen Bau- und Nutzungsgeschichte.
Daran schließt sich ein ausführlicher Rundgang durch
die Anlage an. Zu ihr gehört auch der gesamte Bereich der
Nebengebäude, die das Bruchsaler Schloss in seiner Einzigartigleit
kennzeichnen.

Die Autorin Sandra Eberle M.A. bei der Vorstellung des Führers
Sandra Eberle, die man schon von fundierten Führungen im
Bruchsaler Schloss kennt, ist - wie man es von der renommierten
Reihe der Silbergrauen Führer gewohnt ist - der Spagat zwischen
der notwendigen Ausführlichkeit ihrer Darstellungen und der
erforderlichen Kürze durchweg gelungen. Der Band ist reich
illustriert, enthält aktuelles Fotomaterial und alte Ansichten
von den Innenräumen vor der Zerstörung. Eigentlich selbstverständlich,
und dennoch angenehm praktisch ist der Verweis auf die Pläne
in der vorderen und hinteren Umschlagklappe.
Nur angedeutet ist im Band die bereits im Bau befindliche Rekonstruktion
der Appartements in der Bel Etage, Verlag und Herausgeber hoffen
hier auf einen regen Verkauf des Führers (von dem man zweifellos
ausgehen kann), so dass im nächsten Jahrzehnt ein neuer Führer
*mit* den neuen Räumen erscheinen kann.
Zwei kurze Kapitel über das Städtische Museum und das
deutsche Musikautomatenmuseum (von Thomas Adam bzw. Brigitte Heck)
sowie eine Zeottafel, ein Glossar und ein Verzeichnis ausgewählter
Literatur runden den Band ab.
56 Seiten mit 8-seitigem Umschlag, 53 Farbabbildungen, 16 S/w-Abbildungen
sowie zwei Übersichtsplänen
Format 12,5 x 23,5 cm, Broschur
Verkaufspreis € 4,50
Deutscher Kunstverlag, München
ISBN 978-3-422-02120-4
|