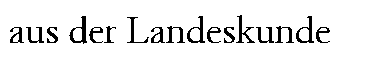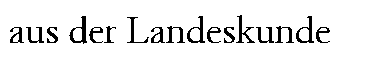|
3.11.09
Ausgestorbener Seidenkuckuck aus Madagaskar im
Naturkundemuseum Karlsruhe – der Letzte seiner Art?
Eine zoologische Besonderheit allererster Güte gibt es
vom 3. November 2009 an für einen Zeitraum von vier Wochen
im Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe zu sehen:
Ein ausgestorbener Seidenkuckuck aus Madagaskar, der vermutlich
der letzte Vertreter seiner Art war, wird im Rahmen der Sonderausstellung „Madagaskar – eine
vergessene Welt“ präsentiert.
Die Gattung der Seidenkuckucke oder Couas kommt ausschließlich
in Madagaskar vor. Dreizehn Arten sind bekannt, wovon zwei schon
in vorgeschichtlicher Zeit ausgestorben sind. Von den übrigen
elf Seidenkuckucks-Arten ist der Delalandecoua die größte
Seltenheit. Sichere Beobachtungen sind nur von der Insel Sainte
Marie (auf Madagassisch: Nosy Boraha) bekannt, die an der Ostküste
Madagaskars liegt. Das letzte Exemplar wurde 1834 beobachtet.
In Naturkundemuseen werden weltweit gerade einmal 14 bis heute
erhaltene Präparate dieser Art aufbewahrt. Als deren jüngstes
gilt der jetzt in Karlsruhe zu bewundernde Delalandecoua, der
eine Leihgabe des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart
ist. Dorthin gelangte er mit einer Schenkung afrikanischer Vögel
von Baron Carl Ferdinand von Ludwig (1784 – 1847) und wurde
mit dem Eingangsjahr 1837 inventarisiert. Weitere Präparate
befinden sich in Museumssammlungen in Paris, Wien, Leiden, Brüssel,
Tring (bei London), Liverpool, New York, Philadelphia, Cambridge
(Massachusetts) und Antananarivo (Madagaskar).

Peter Schouten, Rekonstruktionsbild des ausgestorbenen Seidenkuckucks
(Delalandecoua). © Museum
Seidenkuckucke sind mit knapp 40 cm bis gut 60 cm Länge
wesentlich größer als unser einheimischer Kuckuck
und im Gegensatz zu diesem auch keine Brutschmarotzer, bebrüten
also ihre Eier und versorgen ihre Jungvögel selbst. Außerdem
zeichnen sie sich neben ihrem seidigen Gefieder durch eine unbefiederte,
also nackte Zone bunt gefärbter Haut rund um die Augen aus.
Die farbenprächtigste aller Seidenkuckucks-Arten war der
Delalandecoua, der eine leuchtend metallisch blau gefärbte
Oberseite und einen kastanienfarbenen Bauch aufwies.
Sein buntes Gefieder mag ihn auch zu einer beliebten Beute gemacht
haben. Direkte Bejagung dürfte jedoch als Ursache für
das Aussterben des Delalandecouas weniger bedeutend gewesen sein
als die Zerstörung seines Lebensraumes. Die tropischen Tiefland-Regenwälder
der madagassischen Insel Sainte Marie, in denen er einst zu finden
war, sind heute praktisch vollständig verschwunden. Eine
weitere Ursache für das Aussterben können eingeschleppte
Ratten gewesen sein. Für die Behauptung, der Delalandecoua
habe auch in Regenwäldern im Osten der madagassischen Hauptinsel
gelebt, gibt es keinerlei Belege.
Benannt wurde der Delalandecoua nach dem französischen
Naturforscher Pierre Antoine Delalande (1787 – 1823). Die
wissenschaftliche Erstbeschreibung von Coua delalandei erfolgte
im Jahr 1827 durch den niederländischen Zoologen Coenraad
Jacob Temminck (1778 – 1858) im Jahr 1827. Gerade einmal
sieben Jahre später erfolgte dann leider schon die letzte
belegte Beobachtung dieser prächtigen Vogelart, die im Englischen
auch Snail-eating Coua genannt wird, da er sich offenbar zu einem
großen Anteil von Schnecken ernährte.
Zusammen mit der kostbaren Leihgabe aus Stuttgart zeigt das
Naturkundemuseum Karlsruhe auch ein von dem australischen Künstler
Peter Schouten stammendes Rekonstruktionsbild der ausgestorbenen
Art sowie Präparate von weiteren Seidenkuckucken, darunter
mit dem Blaucoua die bunteste und mit dem Riesencoua die größte
der heute noch lebenden Arten.
(Prof. Dr. Norbert Lenz)
|