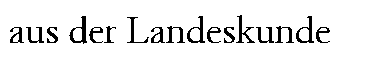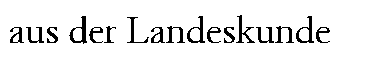|
3.9.09
"Ein Fund von europäischer Bedeutung" -
Vergoldeter Pferdekopf aus Waldgirmes
Bei Ausgrabungen in Waldgirmes (Gemeinde Lahnau/Lahn-Dill-Kreis)
entdeckte ein Team unter Leitung von Frau Dr. Rasbach und Herrn
Dr. Becker (beide Römisch-Germanische Kommission des Deutschen
Archäologischen Instituts) am 12. August 2009 einen lebensgroßen
Pferdekopf einer vergoldeten römischen Reiterstatue.
"
Diese Bronzeskulptur gehört qualitativ zu den besten Stücken,
die jemals auf dem Gebiet des ehemaligen Römischen Reichs
gefunden wurden." Mit diesen Worten enthüllte Staatsministerin
Eva Kühne-Hörmann während einer Pressekonferenz
in Frankfurt im Beisein des Ersten Direktors der Römisch-Germanischen
Kommission, Prof. Dr. Friedrich Lüth und des Landesarchäologen
Prof. D. Egon Schallmayer den lebensgroßen Pferdekopf sowie
einen Schuh des Reiters. Der Kopf ist in seinem Rang als archäologische
Entdeckung an die Seite des Keltenfürsten vom Glauberg oder
der Himmelsscheibe von Nebra zu stellen. "Der einzigartige
Fund zeugt vom geplatzten Traum der Römer, ein unter Ihrer
Herrschaft geeintes Europa im modernen Sinne zu schaffen. Waldgirmes
ist also durchaus ein Fundort von europäischer Bedeutung",
so auch Kühne-Hörmann.

Ansicht des Pferdekopfes
Bild Jürgen Bahlo, Römisch-Germanische Kommission des DAI
Bild im Großformat
Die Ausgrabungen in Waldgirmes hatten in den vergangenen Jahren
immer wieder Bruchstücke eines lebensgroßen Reiterstandbilds
zutage gefördert, das wohl Kaiser Augustus (23 v. Chr. -
14 n. Chr.) darstellt. So wurden etwa ein Pferdefuß und
ein schön verzierter Brustgurt des Pferdes gefunden. Im
August 2009 entdeckten die Archäologen bei der Freilegung
eines der beiden bisher nachgewiesenen Holzbrunnen nun den fast
vollständigen Pferdekopf des Standbilds (ca. 55 cm lang
und 25kg schwer), der in elf Metern Tiefe auf der Brunnensohle
lag. Das Zaumzeug des Pferds ist mit sechs Zierscheiben reich
geschmückt. Auf der Stirn befindet sich eine Platte mit
der Darstellung des Kriegsgottes Mars, an den Seiten sind so
genannte Viktorien (Siegesgöttinnen) angebracht.
Weist der Fund allein schon aufgrund des imperialen Hintergrunds
auf reichspolitische Zusammenhänge hin, so werden diese
durch die hervorragende künstlerische Qualität noch
unterstrichen. Nur zwei unmittelbar vergleichbare Stücke
existieren im Gebiet des ehemaligen Imperium Romanum: die beiden
Reiterstatuen der sog. Cartoceto-Bronzen aus Cartoceto di Pergola
in der Provinz Pesaro/ Urbino, Region Marken, in Italien - die
Originale sind heute im Nationalmuseum in Ancona ausgestellt.
Ihre Datierung und die Identifikation der Dargestellten sind
in der Fachwelt allerdings umstritten. Der Neufund von Waldgirmes
könnte hier völlig neue Datierungs- und demzufolge
auch Identifikationsansätze bieten, denn zumindest die Aufstellungszeit
der Statue in der römischen Stadt an der Lahn lässt
sich auf weniger als zwei Jahrzehnte bestimmen.

Ansicht des Pferdekopfes
Bild Jürgen Bahlo, Römisch-Germanische Kommission des
DAI
Die Reiterstatue muss in den Jahren 4 oder 3 vor Christus -
zur Zeit der Anlage der römischen Stadt Waldgirmes - aufgestellt
worden sein. Um 9 nach Christus, nach der Niederlage des Varus
in der so genannten Schlacht im Teutoburger Wald, gaben die Römer
die Stadt auf. Das Standbild wurde von nachfolgenden Germanen
zerschlagen und der Pferdekopf rituell in dem Brunnen versenkt,
während die anderen Reste weiterverwendet werden sollten.
Die Restaurierung und Konservierung des Pferdekopfs sowie der
mittlerweile mehr als 100 weiteren, größeren und kleineren
Bruchstücke des Reiterstandbilds erfolgt in der Werkstatt
der Hessischen Landesarchäologie. Das Bronze- und Eisenmaterial
sowie die als Oberflächenauflage erhaltenen Goldfolienreste
werden dabei archäo-metallurgisch untersucht. Zugleich werden
die Holzfunde der Brunnenverschalung, des Brunnenfasses und einzelner
Holzgerätschaften restauriert und konserviert. Vorgesehen
ist auch die archäobotanische Untersuchung des Brunneninhalts,
denn dadurch können Einzelheiten des Vegetationsumfelds
der römischen Siedlung festgestellt werden, was dann wiederum
Aussagen zum Charakter der Kulturlandschaft in der Umgebung von
Waldgirmes zulässt.
Die Aufarbeitung der archäologischen Funde - zu der darüber
hinaus auch die Auswertung der umfangreichen Grabungsdokumentation,
des sonstigen vielfältigen Fundmaterials und die Einordnung
der Erkenntnisse in den allgemeinen archäologisch-historischen
Kontext gehört - erfolgt mit Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft sowie aus Mitteln des Deutschen Archäologischen
Instituts. Nach den Worten von Ministerin Kühne-Hörmann
stellt das Land Hessen zudem 150.000 Euro aus Mitteln des Landesamts
für Denkmalpflege zur Verfügung.
Zur Bearbeitung aller Funde und Befunde wird ein interdisziplinäres
Projektteam gebildet, zu dem Provinzialrömische und Klassische
Archäologen, Althistoriker, Numismatiker, Archäozoologen,
Archäobotaniker, Bodenkundler und Metallurgen gehören.
Am Ende wird die Publikation der insgesamt gewonnenen Ergebnisse
stehen. Nach Abschluss der Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten
soll der Pferdekopf des Reiterstandbilds im Rahmen einer Sonderausstellung
an einem zentralen Ort in Hessen der Öffentlichkeit präsentiert
werden.
Der endgültige Aufstellungsort des Reiterstandbilds und
die Präsentation der übrigen Funde werden noch festzulegen
sein. Aus der Region liegt eine von Regierungsbezirk Gießen,
dem Lahn-Dill-Kreis und der Gemeinde Lahnau unterstützte
Machbarkeitsstudie zu einem Museumspark "Römische Stadt
an der mittleren Lahn" vor. Das könnte nach den Worten
der Ministerin vielleicht eine langfristige Perspektive sein.
Sie verwies zugleich aber auf die angespannte finanzielle Lage
der öffentlichen Haushalte. Seit 1993 erforscht die Römisch-Germanische Kommission
des Deutschen Archäologischen Instituts unter jahrelanger
Leitung von Prof. Dr. Siegmar von Schnurbein in Zusammenarbeit
mit der Landesarchäologie Hessen in Waldgirmes die römische
Stadtanlage aus der Zeit des Kaisers Augustus. Maßgeblich
unterstützt werden diese Untersuchungen von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG).
Entdeckt worden war der Siedlungsplatz durch Luftbildbeobachtungen
und Lesefundaufnahmen ehrenamtlicher Beauftragter der Landesarchäologie.
1993 wurden erste Sondierungen im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Kelten,
Römer und Germanen im Mittelgebirgsraum" unternommen.
Von 1996 bis 2000 fanden in einer Kooperation von Römisch-Germanischer
Kommission und Landesarchäologie großflächige
Untersuchungen im Rahmen einer Bauvoruntersuchung zur Erschließung
neuer Gewerbeflächen in Waldgirmes statt.
Seit 2001 ist das Forschungsvorhaben ein Langfrist-Projekt
der DFG, das von dieser bis 2011 gefördert wird. 2009 ist das
Jahr der letzten großflächigen Ausgrabungen am Ort,
die noch bis etwa Mitte Oktober dauern werden. Unterstützt
werden die Ausgraben - wie in den Jahren zuvor - vom Förderverein
Römisches Forum Waldgirmes e.V., der Gemeinde Lahnau und
dem Lahn-Dill-Kreis.
Die Ausgrabungen der vergangenen Jahre haben die Reste einer
planmäßig angelegten zivilen römischen Stadt
zutage gefördert. Sie liefert den Beweis, dass sich die
römische Militär- und Verwaltungsmacht hier einen Platz
geschaffen hat, von dem aus die weitere strukturelle und verwaltungstechnische
Entwicklung der germanischen Gebiete vorangetrieben werden sollte.
Die Siedlung wurde kurz vor der Zeitenwende (4 oder 3 vor Christus)
gegründet, was dendrochronologische Datierungen der Holzbrunnen
belegen, und endete wohl 9 nach Christus mit der sogenannten
Schlacht im Teutoburger Wald oder spätestens mit dem Rückzug
der Römer aus den Gebieten östlich des Rheins im Jahr
16 nach Christus, als diese nach mehreren Rückschlägen
den Plan aufgeben mussten, Germanien rechts des Rheins zur Provinz
zu machen.
Eindrucksvoll ist die Gesamtanlage der Siedlung, die auf einer
regelrechten Stadtplanung beruht. Innerhalb einer Umwehrung,
die von einem holzverschalten Erdwall mit davor liegendem Graben
gebildet wurde, erfolgte die Anlage ganzer Siedlungs- oder Stadtquartiere
mit Einzelbauten unterschiedlicher Funktion und Nutzung. Im Zentrum
entstand auf 2.200 Quadratmetern das Forum mit Basilika, einem
Bautyp wie er im mediterranen Raum als Verwaltungs-, Gerichts-
oder auch Markthalle Verwendung fand.
Ein solcher Ort bringt die Macht des römischen Staats optisch
zum Ausdruck, wenn die Gesamtanlage eine eindrucksvolle Gebäudegestaltung
und entsprechende -höhen erreicht und die Bauwerke noch
dazu innen und außen entsprechend aufwändig gestaltet
sind. Das allein hat aber den Römern offenbar nicht genügt:
Vor der großen Halle errichteten sie noch fünf steinerne
Postamente, auf denen die Standbilder der höchsten Repräsentanten
des Staats Aufstellung fanden. Es liegt auf der Hand, dass hier
nur die Statuen des regierenden Kaisers Augustus sowie die seiner
engsten Verwandten und Vertrauten standen, um das Imperium Romanum
zu repräsentieren. Im Zentrum kann dabei nur der Kaiser
selbst gestanden haben, dessen Abbild im Verständnis der
Antike seine Anwesenheit am Ort verkörperte.
Nicole Kehrer,
Deutsches Archäologisches Institut
|