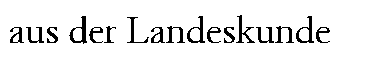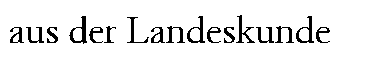|
30.3.10
Unterwasserarchäologie im Ausfluss des Bodensees
Ein deutsch-schweizerisches Kooperationsprojekt
Luftbilder machten darauf aufmerksam, dass auf dem „Orkopf“ einer
inselartigen und meist unter Wasser liegenden Seekreidebank mitten
im Ausfluss des Bodensee-Untersees zwischen Stiegen (D) und Eschenz
(CH), rätselhafte Holzpfähle aus dem Untergrund ragen.
Diesem spannenden Phänomen gehen Schweizer und deutsche
Archäologen nun gemeinsam im Rahmen eines internationalen
Projektes nach.
Die Untersuchung der seit 1986 bekannten, durch die deutsch-schweizer
Landesgrenze geteilten Fundstelle wurde vor allem im Rahmen des
2008 angelaufenen, internationalen Interreg IV-Projektes „Erosion
und Denkmalschutz im Bodensee und Zürichsee“ möglich.
Seither hat ein Team aus Taucharchäologen des Amtes für
Archäologie des Kantons Thurgau und des baden-württembergischen
Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium
Stuttgart die Pfahlstrukturen in jährlichen, jeweils einige
Wochen andauernden Kampagnen untersucht. Trotz schwieriger Arbeitsbedingungen – die
Fundstelle ist nur mit dem Boot zugänglich, die Pfähle
stecken in bis zu 12 m Wassertiefe und es herrschen durchweg
kräftige Strömungen – führten die gemeinsam
durchgeführten Aktionen zu erstaunlichen Ergebnissen: Es
konnten Pfosten einer Steg- oder Brückenkonstruktion und
sogar gleich mehrere Pfahlbaudörfer entdeckt werden, die
an dieser exponierten Stelle errichtet worden waren.

Gemeinsam bergen Taucharchäologen des baden-württembergischen
Landesamtes für Denkmalpflege im RPS und des Amts für
Archäologie des Kantons Thurgau von der Erosion bedrohte
Holzpfähle. Bild: Landesamt für Denkmalpflege BW
Die Holzpfähle wurden im Labor des Landesamtes für
Denkmalpflege in Hemmenhofen untersucht und konnten vor kurzem
datiert werden: Eine von Nordwesten auf die Insel zuführende
doppelte Pfostenreihe stammt aus dem Jahr 676 n. Chr., es handelt
sich also um einen Steg oder eine Brücke aus dem frühen
Mittelalter. Im Nordosten des Orkopfes konnten Hauspfosten einer
um 1900 v. Chr., also in der gerade beginnenden Bronzezeit errichteten
Siedlung festgestellt werden. Im Südwesten des Orkopfes
wurden ebenfalls zahlreiche Hauspfosten auf einer größeren
Fläche entdeckt. Sie stammen von zwei verschiedenen steinzeitlichen
Dörfern. Das eine wurde bereits um 3890 v. Chr. errichtet
und gehört zu den ältesten vom Bodensee bekannten Pfahlbausiedlungen.
Das zweite steinzeitliche Dorf ist mehr als 1500 Jahre jünger
und datiert zwischen 3300 und 3100 v. Chr.
Weitere Pfahlstellungen und verschiedene Funde aus Stein-, Bronze-
und Römerzeit sowie dem frühen Mittelalter zeugen davon,
dass der Orkopf in der Vergangenheit rege frequentiert wurde.
Spätestens ab der Römerzeit ist auch mit regelmäßigem
Schiffsverkehr zu rechnen. Überhaupt waren Engstellen im
Bereich von Seeausflüssen von je her für den Menschen
interessant. Oftmals überquerten hier verschiedene uferparallele
Landwege das Gewässer. Der Orkopf könnte daher in der
Vergangenheit eine verkehrsgeografische Schlüsselposition
eingenommen haben. Von seiner Untersuchung sind auch in Zukunft
noch spannende Ergebnisse zu erwarten.
Allerdings drängt die Zeit: Vor allem die steinzeitlichen
Pfähle ragen bis zu einem Meter hoch aus dem Sediment und
sind stark von der Erosion bedroht. Aber nicht nur deswegen wird
die Fundstelle jetzt untersucht. Da im Zuge des Interreg-Projektes
Fragen zur Dynamik von Erosions- und Sedimentationsvorgängen
im Bodensee nachgegangen werden, nimmt die Ausflussschwelle des
Bodensees auch hier eine Schlüsselposition ein.

Die Fundstelle im Ausfluss des Bodensees in den Rhein östlich
von Stein am Rhein. Satellitenbild: Google Earth
|