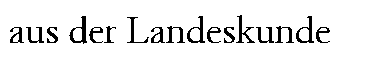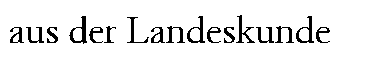|
1.7.10
Vogtsburg-Bischoffingen (Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald) „Käppele“
Archäologen auf den Spuren des ältesten Breisgaudorfs
(rpf) Bereits vor 7500 Jahren wussten jungsteinzeitliche Siedler
die fruchtbaren Böden und das günstige Klima des Kaiserstuhls
zu nutzen. Spuren dieser Besiedelung werden jetzt erforscht:
Im Vorfeld einer Baumaßnahme graben Archäologen
des Regierungspräsidiums Freiburg am nordwestlichen Ortsrand
von Bischoffingen auf einem ca. 1 ha großen Areal.
"Die topographische Lage war für vorgeschichtliche
Siedlungen ideal: Ein leicht nach Süden abfallender Hang,
ein kleiner (heute verdohlter) Bach, Lößböden,
der damals noch von einer Schicht fruchtbarer Schwarzerde bedeckt
war. Seit über
100 Jahren findet man hier daher Reste von vorgeschichtlichen
Siedlungen und Friedhöfen", so Dr. Andreas Haasis-Berner,
Archäologe des Regierungspräsidiums Freiburg.

Grundriss eines der Langhäuser. Da die Häuser aus Holz
waren, bleiben nur die Verfärbungen im Boden erhalten und
sind hier zur besseren Veranschaulichung rot markiert. Bild:
w.z.
Erstmals in der 80-jährigen Geschichte der archäologischen
Denkmalpflege in Südbaden, ist es nun gelungen, vollständige
Hausgrundrisse der ersten Bauern im Breisgau freizulegen und
zu untersuchen.
Den Aufbau der Langhäuser kennzeichnen drei Reihen von
großen Pfosten, die ein Satteldach aus Riet oder Stroh
trugen. Die Wände bestanden aus Reihen von kleineren Pfosten,
Weidengeflecht mit Lehmverputz oder Spaltbohlen. Erhalten sind
davon heute nur noch die in den Boden eingetieften Löcher
der Pfosten, die sich anhand der Verfärbung im Boden erkennen
lassen . Abstände und Lage der Pfostenlöcher lassen
den Schluss zu, dass es sich um große, etwa 8 m breite
und über 30 m lange Holzhäuser handelte. Der Lehm für
den Wandverputz wurde direkt an den Längsseiten der Häuser
entnommen, so bildeten sich hier Gruben, die sich heute ebenfalls
noch nachweisen lassen. Insbesondere anhand der Scherben von Keramikgefäßen
kann die Bauepoche datiert werden. Neben fein verziertem Geschirr
finden sich vor allem kleine und große Vorratsgefäße
mit durchlochten Ösen, die sich im Haus aufhängen ließen.
Aufgrund der bandförmigen Muster, mit denen die Gefäße
verziert waren, wird diese Zeitstufe „Bandkeramische Kultur“ genannt.

Mitarbeiter der Archäologischen Denkmalpflege beim Freilegen
eines Gefäßes
aus Keramik. Bild: Andreas Haasis-Berner, RP Freiburg
Ergänzt wird das Fundmaterial durch verschiedene Feuersteingeräte.
Die bandkeramische Epoche steht für den Prozess der Sesshaftwerdung,
der auch als 'neolithische Revolution' bezeichnet wird. Im Gegensatz
zur nomadischen Lebensweise der alt- und mittelsteinzeitlichen
Menschen, die ihren Nahrungsbedarf durch Jagen und Sammeln zu
decken suchten, bauten die jungsteinzeitlichen Bandkeramiker
ab etwa 5500 v. Chr. erstmals Getreide an. Sie errichten feste
Häuser und dorfartige Siedlungen. Durch den Anbau von Getreide
konnten mehr Menschen ernährt werden. Gleichzeitig wurden
Mitglieder der Siedlungsgemeinschaft teilweise von unmittelbar
zum Nahrungserwerb nötigen Tätigkeiten freigestellt.
Das begünstigte eine Vielzahl technischer Innovationen und
handwerklicher Spezialisierung, wie z. B. dem Hausbau, der Töpferei
oder in der Steinbearbeitung.
Die Menschen der Bandkeramik griffen aber auch in die Umwelt
ein: Sie rodeten für den Feldbau und die Siedlungen Wälder
und setzten dadurch Erosionsprozesse in Gang . Durch abfließende
Erdmassen des über der Ausgrabungsfläche aufragenden
Enselbergs wurden die 7000 Jahre alten Siedlungsspuren überdeckt
und blieben so erhalten, während sie andernorts längst
der Erosion zum Opfer fielen.
Durch ihre Ausgrabungen erhoffen sich die Archäologen Aufschlüsse über
die Größe und Dauer der Siedlung, die Größe
der Häuser, die Nutzungsbereiche innerhalb der Häuser.
Es werden auch umfangreiche naturwissenschaftliche Untersuchungen
durchgeführt. Durch das Schlämmen von Bodenproben erhält
man Aufschlüsse über die Pflanzenreste und kann daran
erkennen, welche Pflanzen durch die ersten Bauern im Breisgau
angebaut wurden und welche Pflanzen in der Umgebung wuchsen und
genutzt wurden. Die Untersuchungen der Bodenkundler geben Aufschluss
auf die Fruchtbarkeit der Böden und die Umweltfolgen durch
die landwirtschaftliche Nutzung.
Alle diese Daten bilden die für den Breisgau einmalige
Grundlage für die Rekonstruktion des vorgeschichtlichen
Siedlungsbildes und der damaligen Umwelt. |