|
|
Die heutigen
Ortsteile im 18. und 19. Jahrhundert
|

Johann Georg Vetter
(1681 - 1745): Karte des Oberamts Colmberg
Hist.
Verein für Mittelfranken
Die oben abgebildete
Karte zeigt Geslau und seiner heutigen Teilorte, die offensichtlich
umfriedet sind. In der noch erhalten gebliebenen und bei Hahn (1962)
beschriebenen rund 60-seitigen Aidenauer Gemeindeordnung (Oberamt
Colmberg, 1.12.1732), die in ähnlicher oder gleicher Weise
für Geslau gegolten haben dürfte.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf (Hahn, 1962), der
über die durch die letzte Aidenauer Ortsführer-Familie
bewahrte Ordnung einsehen konnte. Es sollen hier auch nur einige
Aspekte angesprochen werden, die Hahn erläuterte.
Danach waren "in der starken Dorfumzäunung (Hecke) sechs
Lücken. Diese Erlücken waren Lücken im Zaun einer Hecke,
von einem Gatter verschlossen und 12 Fuß breit. Sie waren in der
Erbfolge nahe gelegenen Besitzern zugeteilt, sie zu öffnen, wenn
die Arbeit auf dem Felde stattfand und sie wieder zu schließem,
nur Viehtreibern, Mist- und Gereidefuhren durch die Erblücken zu
lassen, aber keine Holzfuhren. " (Hahn, 1962 S. 11).
Die Dorfordnung regelte regelte daneben die Abgaben und den
Ausfuhrzoll, der an die brandenburgische Haupt- und Wegzollstatt Geslau
zu entrichten war.
Der Bauernmeister, der jeweils für 1 Jahr in der
verpflichtenden Versammlung gewählt wurde, musste für
die jährliche Verlesung der (60-seitigen!) Dorfordnung sorgen, die
jeder unbewaffnet besuchen musste. Die Ordnung regelte u. a. die
Obsternte, das Anpflanzen von Weiden zur Unterhaltung der Straße,
enthielt eine Feuerordnung und viele weitere Punkte.
|
|
 Ortsplan
1742
Fürstentum
Ansbach Karten und Pläne, Nr. 128
Ortsplan
1742
Fürstentum
Ansbach Karten und Pläne, Nr. 128
Der Vergleich des obigen Ortsplanes
mit der Karte der Uraufnahme von 1834 (siehe weiter unten) zeigt, dass
es in den 90 Jahren - mit Ausnahmen von Hauserneuerungen - zu keinen
wesentlichen Veränderungen des Gebäudebestandes kam.
|
Zur Abbildung unten:
Der Begriff Unterthan bezieht sich auf die "juristische" Person, nicht
aber auf die "natürliche Person", d. h. der Unterthan und seine
gesamte Familie wird als eine "Person" gezählt. |
Im
Jahr 1787 gibt Johann Bernhard Fischer in dem Buch "Statistische und
topographische Beschreibung des Burgraftums Nürnberg unterhalb des
Gebürgs; oder des Fürstentums Brandenburg-Anspach" eine
ausführliche
Beschreibung der Region Colmberg: |

... "Hierzu gehoert
vornehmlich:
a)
der
Waldgrund. Erzieht sich links auf de Seite von Colmberg gegen die
rothenburgische Graenze, bis er ueber den Ortschaften Geßlau und
Windelspach seine Endschaft erreicht." ... "Die Aussicht wird durch den
Anblik mehrerer nahen und fernen Ortschaften, besonders des auf einem
sehr hohen Berg liegenden colmberger Schloßes, dann de Doerfer
Binzwang, Stettberg, Geßlau und Auerbach, so wie den, sich im
Grunde hinschlaengelnden Altmuehlfluß, recht sehr verschoenert
... Die Beschaffenheit und Guete des Erdbodens im Oberamt
Colmberg ist unterschiedlich. Im walder und brunster Grund findet man
starkes und lettigtes, ..., Erdreich. In beeden erstern Gegenden bauet
der Landmann meistens rauhen Dinkel oder Spelz, und Haber, in einer
außerordentlichen Menge; Korn und andere Feldfruechte sind
seltner... Von diesen Produkten sind Dinkel und Habern die einzigen,
welche der Landmann zu seiner Nahrung, teils zum Verkauf bring, teils
aber auch in das Mastvieh verfuettert, und sonach mit letzterem und dem
Hammelviehe eine betraechtliche Handlschaft nach Augspurg und in die
franzoesischen Lande treibt. Was der Unterthan dieser Gegend an
uebrigen Fruechten, als Korn und Sommerwaizen und dergleichen erbauet,
wird mehrerntheils in das Hauswsen und zur Schweinatzung verbraucht. Da
die mehresten Wiesen am Altmuehlflus gelegen sind, so ist ihre
Beschaffenheit durchgengig vorzueglich gut; zumal sie durch den oeftern
Austritt und Ablauf dieses Wassers von Zeit zu Zeit angefeuchtet
werden, und deswegen gar keiner Duengung beduerfen. Nicht selten tritt
aber auch der Flus zur Unzeit aus seinen Ufern, und vereitelt die
Hofnung einer gesegneten Heuaernde... Die Pferdezucht, ..., ist zur
Zeit aeuserst vernachlaessiget und kommt beynahe ganz in Abgang. Dafuer
ist die Rindviehzucht desto betraechtlicher. Die Bienenzucht ist von
keine Erheblichkeit, Fische giebt es zwar im Altmühlfluß
ziemlich und von verschiedenen Gattungen; ... Vorzeuglich zalreich und
schmackhaft sind die altmuehl Krebs, und auch diejenigen, welche in
andern Baechen des Oberamts gefangen werden, nur koennen sie, wegen des
allzuhaeufigen Ausfangens zu keiner ordentlichen Groese kommen. Unter
den vielen ansehnlichen Waldungen, sind der Fuerst in sulzer, die
Waidlach in windelspacher und das Seeholz in comberger forstey die
betraechtlichsten, und mehrentheils mit Fichten bewachsen. Nur an
einigen Orten findet sich Eichen, Buchen, Birken, Eschen, und
Forlnholz. Von merkwuerdigen Naturprodukten, Manufakturen und Fabriken
ist diese Landesgegend gaenzlich entbloeßt. Daher sind den
Feldbau und Viehzucht die einzigen Nahrungszweige der dasigen
Einwohner. ...Ihre haeußliche Einrichtung ist nicht kostbar; aber
im Eßen und trinken thun sie es andern Gegenden ziemlich bevor.
Die Einwohner im brunster und wald Grund lieben Koffee und Wein;...
|
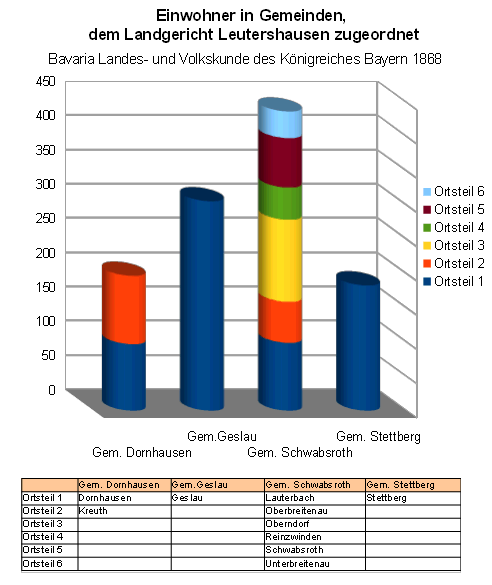 Um
das Jahr 1787 lebten, ohne Stettberg (dieses war einem anderen Amt
zugeordnet), nicht genz 200 Unterthanen in den Teilorten von Geslau. 80
Jahre später waren es etwas mehr als 1100 Einwohner, was nicht
wesentlich mehr war, da die damaligen Familien durchschnittlich viel
größer waren. Um
das Jahr 1787 lebten, ohne Stettberg (dieses war einem anderen Amt
zugeordnet), nicht genz 200 Unterthanen in den Teilorten von Geslau. 80
Jahre später waren es etwas mehr als 1100 Einwohner, was nicht
wesentlich mehr war, da die damaligen Familien durchschnittlich viel
größer waren.
Im Jahr 1818 verzeichnet das Alphabetische Verzeichniß aller
Rezatkreise für Geslau (ohne die heutigen Teilorte) 50
Feuerstellen, 50 Familien und 273 Seelen.
1864 belegt das "Verzeichniß der Gemeinden in
Bayern" für Geslau im Jahr 1861 62 Familien mit 306
Seelen.
Voraussetzung dazu war, dass die Nahrungsmittelproduktion mit der
steigenden Bevölkerung Schritt hielt.
So
beschreibt und begründet Johann Bernhard Fischer im Jahr
1802 in seinem in Nürnberg verlegten Buch "Ueber Gemeinheitstheilungen und die Urbarmachung der
Huthschaften und oeder Plätze; besonders in dem Fürstenthum
Ansbach, aber auch anwendbar auf die uebrigen Lande des
fränkischen
Reichs-Kreises" und zwei Jahre zuvor in dem Buch "Ueber den Anbau auslaendischer Getraidarten und
einiger anderen nutzbaren Gewaechse in Deutschland; ihre Eigenschaften,
Cultur, Nutzen und Gebrauch"
Maßnahmen zur Steigerung der Agrarproduktion.
So schlägt er - in dem König Friedrich Wilhelm IIII von
Preußen gewidmeten Buch folgende Maßnahmen vor.
- die
Umnutzung der gemeindeeigenen Hutungen und
Brachflächen bei
- gleichzeitigem
Übergang von der traditionellen Sommerweide zur generellen
Stallhaltung der Rinder vor ,
- da
die Stallhaltung dem Fleischansatz zuträglich ist und gleichzeitig
kein natürlicher Dünger für die Ackerflächen
verloren geht und andererseits das Gras der der Hutungen dann
für den Winter als Heu eingelagert werden kann.
- die
Aufgabe der traditionellen zelgengebundenen Dreifelderwirtschaft
(Sommergetreide, Wintergetreide, Brache) und die Neuaufteilung der
Flur, die infolge des Realteilungsrechtes stark zersplittert war und
die verstreut liegenden Felder nur mit erhöhtem Zeitaufwand zu
bewirtschaften sind.
Allerdings
sieht er die erste "Flurbereinigung" hinsichtlich der
Durchführung selbst sehr kritisch:
|
|
|

Konstitutionssäule von Gaibach bei Volkach a. Main zur Erinnerung
der Verfassung des Königreiches Bayern von 1818 (1828 eingeweiht)
By Reinhard Brunsch (Own work) CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia
Commons
|
"Das
nuetzliche einer solchen Idee wuerde weit ueber die Begriffe des
gemeinen Mannes hinausreichn; die Ausmittlung der Gleichstellungen
gegen den bisherigen Ertrag der Ackerwirthschaften wuerde das schwerste
Problem fuer den Theilungskommisaer - und ungeheure Kosten, unzaehlige
Prozesse, Klagen ueber Verkuerzungen, und Undank, wuerden, neben dem
groeßten Mismuth, die Folge eines solchen Unternehmens seyn."
"In
Preußen wurde die
Gemeinheitsteilungsordnung von 1821 im Jahr 1872 geändert und auf
die
Zusammenlegung von Grundstücken, die nicht im gemeinschaftlichen
Eigentum stehen, erweitert. Damit wurde die Zusammenlegung eine
selbständige Maßnahme der Neuordnung." (wikipedia)
Zu der Umsetzung (vor allem der letzten) Maßnahmen, kam es dann
im
Bereich der Frankenhöhe nicht mehr, denn 1806 gelangten nach dem
Sieg Napoleons über das Königreich Preußen (nach
dem
Frieden von Paris) weite Teile Frankens an das Königreich Bayern.
Zur Geschichte Bayerns:
|
| Geslau
und seine heutigen Teilorte im 19. Jahrhundert (
|
Die folgenden
Jahrzehnte (1808 - 1864) dienten u. a. der topographischen Uraufnahme (zwecks Besteuerung)
des Königreiches Bayern und der wissenschaftlichen
Erforschung des Königreiches Bayerns. Gleichzeitig wirde eine
Armee von Freiwilligen aufgebaut, z. B. das Artillerie-, Husaren- und
Jägerkorps. Beim Jägerkorps melden sich im Jahre 1814
u. a. Simon Reuter (Gunzendorf), Joh. Georg Wender (Geslau) und Joh.
Georg Bauer (Geslau) sowie beim Husarenkorps Joh. Martin Ritter
(Stettberg). (Intelligenzblatt des Rezat-Kreises, Ansbach 1814)
1810 wurden die Ruralgemeinden im Landgericht Ansbach gebildet:
Die Gemeinde Geslau umfasste die Ortsteile Geslau am Wald, Gunzendorf,
Steinach Aidenau, Kreuth und Dornhausen. Die heutigen Ortsteile
Schwabsroth, Reinswinden, Oberndorf, Oberbreitenau, Unterbreitenau und
Lauterbach bildeten die Gemeinde Schwabsroth. Der heutige Ortsteil
Stettberg gehörte zur Gemeinde Binzwangen. und Hürbel zu
Frommetsfelden.
|
|
Heutiger
Ortsteil Geslau
|
Aus der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt eine "Beschreibung der Häuser und Höfe der Bauern
und Köbler in Gunzendorf,
Geslau und Traisdorf" der wohl hohenlohischen Untertanen.
Erste dokumentierte
Vermessungen sind belegt durch die
" Forderung der Regierung Ansbach an Hans Michael Hauf und Hans Georg
Grünstäudel, beide zu Geslau auf Erstattung der Kosten
für Gütervermessung" aus dem Jahre 1744
|
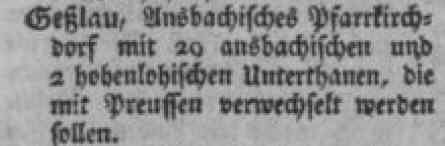 Geßlau (1799-1804) ,
Ansbachisches Pfarrkirchdorf mit 20 ansbachischen und 2 hohenlohischen
Unterthanen, die mit Preussen verwechselt werden sollen Geßlau (1799-1804) ,
Ansbachisches Pfarrkirchdorf mit 20 ansbachischen und 2 hohenlohischen
Unterthanen, die mit Preussen verwechselt werden sollen
Quelle: Projekt
Topographia Franconiae der Univesität Würzburg: Geographisches
Lexikon 1799-1804,
Dass auch das 18. Jahrundert
von eine Zeit für Verbrechen war, belegt ein Protokoll in der Niedersächsischen Staats- und
Universitätsbibliothek über ein besonders
verwerfliches Verbrechen. Danach wurde am 2. Mai 1710 der Pfarrer
Johann Veit und seine Tochter sowie die Dienstmagd (wohl im
Pfarrhaus) von 7 bis 8 Männern überfallen, geschlagen und
gedrosselt. Der Überfall endete mit dem Velust zahlreicher,
darunter auch einiger liturgischer Gegenstände. Die
Überfallenen wurden gefesselt in der Küche aufgefunden. Dem
Bericht folgt eine Aufstellung der gestohlenen Gegenstände.
|
 |
|
Eine
genauere
Beschreibung mit Hausnummern liefert aus unterschiedlichen Quellen
zusammengestellt Jehle (2009, S 859)
Geslau (Ende 18.- Anfang 19. Jahrhundert)
Ortsstatistik 1792
BB-AN KAColmberg
5
Halbhöfe (4,23,24,30,38), 9
Köblergüter (9, 15,25,29, 31-33,37, 39), 1 Köblergut mit
Backgerechtigkeit (26), 1 Mühle Köblergut (22) ,1 Schmiede
Köblergut (28), 9 Söldengütlein
(5,13,14,18,19,35,42,43,44), 1 Söldengütlein mit Backrecht
(34), 2 Tafernwirtschaften (12, 27), 1 Haus (46), 1 Leerhaus (20)
BB-ANKAComberg
Pfarrpfründe
Colmberg 1
Köblergut (10), 1 Köblergut mit Backrecht (11), 2
Söldengütlein (6,36), 1 Bad-Söldengütlein
HL-SF Amt Schillingsfürst:
1 Hof
(21)
Jsp Wü VerwA
Burgbernheim
(1 Hof 3), 2 Halbhöfe (16,17)
Herrsch. G.
(Rieterische Stiftwverwaltung Kornburg )
Zehntscheune
(7)
KKG:
Pfarrkirche, Widdumgut (1), Schulhaus (2); Kuhhirtenhaus,
Ochsenhirtenhaus, Brechhaus (40/41)
Obwohl Geslau unter ansbachischer Verwaltung stand, gab es in Geslau
verschiedene Grundherrschaften. So besaß Veit Fehler zu Beginn
des
18. Jahrhunderts einen Hof, der Hohenlohe Schillingsfürst
abgabepflichtig war. 1717/1718 musste er offensichlich laut noch nicht
eingesehener Quellen bei der Deutschen Digitalen Bibliothek den hohenlohischen
Hof in Geslau verkaufen und wurde 1720 gar
durch den ansbachischen Schultheißen zu Gunzendorf arrestiert.
Zwei der Seckendorffeschen Höfe (vergl. Kapitel Mittelalter)
in Geslau gingen im 16. Jahrhundert in die Ausstattung des
Würzburger Juliusspitals ein (Jehle, 2009, 567). Merzenbacher
(1979, S. 159) schreibt mit Bezug auf das Archiv des Juliusspitals: "
In dem brandenburgisch-ansbachischen Ort Geslau bei Windsheim
besaß das Juliusspital 1748 zwei vogteiliche Höfe,
während die Dorfherrschaft dem fürstlichen Haus
Brandenburg-Ansbach zukam." Nach Ulrich
Haller (1398) gelangten die Zehnten von Geslau an die Rieter von
Kornburg. Im Jahr
1681 hielten sie noch einen Anteil von zwei Drittel. Die
Zehntscheue war 1792 der letzte sichtbare Zeuge ihres
herrschaftlichen Einflusses in Geslau. Im Jahr 1829 wird im
"Intelligenzblatt für den Rezatkreis" (siehe
rechts) alle eingelegten Waren an den Meistbietenden verkauft. Im Jahr
1830 wird die Zehntscheune verkauft. Bei Rechter (2012) sind
Käufer
(Greiffenklau zu Vollraths) und Nachfolger (Joh. Andreas Hornung)
angegeben. Schließlich gelangt die Zehntscheune in die
Hände des
Darlehenskassenvereins Geslau und Umgebung. Heute steht an Stelle der
Scheune ein Wohnhaus.

Einen Eindruck davon wie die Zehntscheune ausgesehen mag, gibt die
erhaltene Zehntscheune von Berglein.
|
|
|
|
Zum Zeitpunkt der
Uraufnahme stimmt
die Bebauung noch mit dem Gebäudebestand von 1792 überein.
- Seit dem Mittelalter
waren die Bauern ihren jeweiligen Grundherren eine Abgabe in Form des
Zehnts (ca. 10 %) der Erträge in Naturalien oder Geld schuldig. Es
gab unterschiedliche Zehnte .
Ab dem 4. Juli 1818 sind zwar im Bayerischen Königreich die
Zehntrechte abgeschaft. Doch wird noch 1841 ein Urteil des
Gerichtes von Leutershausen im Allgemeinen Anzeiger für das Königreich
Bayern, in dem das strittige Zehntrecht für ehemals
Würzburger Besitzungen in den Steuergemeinden Buch am Wald,
Geslau, Gunzendorf und Schwabsroth durch feste Geldbeträge zum
öffentlichen Verkauf angeboten wird. Durch diese allgemein
üblichen Ablösesummen verschuldeten sich viele Bauern.
Die Reaktionen darauf gestalteten sich unterschiedlich:
- in der
verstärkten
Auswanderung, vor allem nach Nordamerika ab den 1830-er Jahren
- in der Gründung
von (Kredit-) und sonstigen Genossenschaften
- in der Gründung
von Versuchsanstalten für Landwirtschaft und Gartenbau
(Siehe auch
Hausgeschichte)

|
 |
von
Tilman2007 (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
oder CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via
Wikimedia Commons
Köblerhaus aus Oberfelden im Fränkischen Freilandmuseum
Bad Windsheim
Weitere Bilder zum Köblerhaus aus Oberfelden
|
|

Tracht der Frauen um 1858 in Geslau
|
Geslau am Wald (1856).
Gemeindevorsteher: Joh. Mich. Sauerhammer.
Geslau am
Wald , Pfarrdorf , 4 St. von Leutershausen, protest. 47
Häuser, 66 Fam., 276 Seelen. Mit einer Pfarrei und Schule. 1
Bader, 2 Brauer und Wirthe, 1 Mühle, 2 Schmiede, 3 Bäcker, 1
Färber, 1 Eisenhändler, 1 Haubenmacher, 3 Krämer, 2
Schreiner, 6 Weber, 4 Metzger, 1 Büttner, 4 Schneider, 3
Schuhmacher, 1 Lichterzieher, 1 Wagner, 1 Zimmermeister, 1 Hebamme
Quelle:
Vetter, Eduard: Statistisches Hand- und Adreßbuch von
Mittelfranken im
Königr. Bayern. Mit höchster Bewilligung aus amtlichen
Quellen
bearbeitet. Ansbach, 1856 |
|
 / /
|

|
Der
ehemalige
Standort der Mühle, die heute nicht mehr vorhanden ist, ist in der
Karte der Uraufnahme
im Bereich der Bergstraße 14 ersichtlich (vgl. auch die
Karte der
historischen Uraufnahme unten). Der heutige nach NNW abzweigende
Teil
(ebenfalls Bergstraße) war zur Zeit der Uraufnahme der
aufgestaute
Zulaufkanal zur Geslauer Mühle. Da der normalerweise
unscheinbar dahinfließende Karrachbach recht beachtliche
Hochwässer erzeugen kann, wurden die benachbarten
Häuser auf tiefem Fundament gegründet.
|

Karte der
Uraufnahme
© Bayerische
Vermessungsverwaltung 2013
Zitat
Von
Allodifizierung oder Allodifikation spricht man wenn ein Lehen in ein Allod,
d.h. freies Eigentum, umgewandelt wird.
Beispiel: M ist ein Vasall des
Landgrafen von H. Dieser hat ihn mit der Burg M belehnt. Später
erhält M die Burg als freies Eigentum (Allod).
Ende
des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Deutschland
alle verbliebenen Lehen allodifiziert und damit zu Grundeigentum im
heutigen Sinne umgewandelt.
|
| die
heutigen Teilorte in alphabetischer Reihenfolge:(noch unvollständig bearbeitet)
|
Heutiger
Ortsteil Aidenau
|
Aidenau
(1799-1804) Weiler von 14 in das Kameralamt
Kolmberg gehoerigen Unterthanen, in dessen Fraischdistricte es auch
liegt.
Im Landesarchiv von Baden-Württemberg ist das Gesuch der Witwe Anna Margareta Imschloß um
Nachlass des Handlohnes aus dem Jahre 1774 dokumentiert, die das
Gut an einen ihrer beiden Söhne übergeben will. Der
sog. Handlohn war eine einmalige Zahlung, die neu Besitzer für die
Überlassung eines Gutes an den Lehnsherrn zu zahlen hatten.
Ob dieses Gesuch von Erfolg gekrönt war ist mangels Einsicht in
das Dokument nicht zu sagen. Allerdings weist Rüdel
(2000) einen lückenlosen Besitz des 1685 geteilten
Hofes und fortan unter Hof 9 geführten in der Familie
Imschloß bis heute nach.
Aufgrund dieser Quelle stellt sich die Frage, ob dieser Hof im Jahr
1774 hohenlohisch war und zum ansbachischen Besitz wechselte, denn
Jehle (2009) bezeichnet diesen Hof dem Kastenamt Colmberg
zugehörig.
Vgl. auch "Landesvergleich zwischen dem Königl.
Preußischen Fürstenthum Ansbach und der Fürstl.
Hochenlohe-Neuensteinischen Linie" aus dem Jahr 1796
Aidenau
(1856)
siehe Gunzendorf 1856
|

|
Heutiger Ortsteil
Dornhausen
|

Dieser
alte fränkische Dreiseithof in Dornhausen war zum Zeitpunkt
der Aufnahme im Jahr 2003 schon aufgegeben. - 2012 war an seiner Stelle
ein neues Haus errichtet worden.
|
Dornhausen (1799 - 1804),
Weiler mit 15 in das Kameralamt Colmberg gehoerigen Unterthanen.
Quelle: Projekt
Bundschuh Topographia Franconiae der Univesität
Würzburg: Geographisches
Lexikon 1799-1804,
Dornhausen (1846).
Gemeindevorsteher: Georg Michael
Fries.
Dornhausen,
Dorf, 4 St. v. Ansb., prot. 19 Häusser, 25 Fam. 91 Seel. Zur
Pfarrei u. Schule Geslau. 1 Haus zur Pfarrei und Schule Buch am Wald. 1
Wirth, 1 Schmied, 1 Weber.
Kreuth, Weiler, prot. 16
Häuser, 15 Fam., 87 Seelen,. 1 Wirth, 1 Weber, 1 Schmied
Quelle:
Vetter, Eduard: Statistisches Hand- und Adreßbuch von
Mittelfranken im
Königr. Bayern. Mit höchster Bewilligung aus amtlichen
Quellen
bearbeitet. Ansbach, 1846 (Bayerische
Landesbibliothek ONLINE)
|
| Heutiger Ortsteil Gunzendorf |
Den (Wiederauf-)Bau einer
Mühle belegen Dokumente aus dem Jahr 1714, der
(zunächst ?) durch Brandenburg-Ansbach verweigert wird.
Gunzendorf (1799-1804),
Dorf von
21 Hohenlohischen Haushaltungen, deren Wohlstand vortrefflich ist
pfarren nach Geßlau und sollen mit Preußen in Wechsel
kommen.
Gunzendorf,
Weiler. Ansbach hat daselbst 7 Unterthanen, die in das Amt Colmberg
gehoeren; 21 Unterthanen sind Reichsritterschaftlich.
Quelle: Bundschu Projekt
Topographia Franconiae der Univesität Würzburg: Geographisches
Lexikon 1799-1804,
Zu welchen Problemen
diese Verflechtung unterschiedlichen grundherrschaftlichen
Besitzes führte zeigt der "Prozess vor dem Reichshofrat in Sachen
Hohenlohe-Schillingsfürst gegen Brandenbur-Ansbach wegen Festnahme
von Untertanen im Fall der Schwängerung der Maria Rauhbächer
durch Hans Keidel aus Gunzendorf" aus dem Jahr 1670 oder ein
Dokument wegen "Differenzen wegen des vom Oberamt Colmberg
beanspruchten Rechts zur Feuerschau und Kaminfegerei in
Häusern von h.schillingsfürstischen Untertanen zu Gunzendorf
und Geslau;" aus dem Jahr 1709
Über
diese beabsichtigen Abtretungen Hohenlohischer Ansprüche besteht
ein "Protokoll
über die Abschätzung der im Landesvergleich gegenseitig
abzutretenden Besitzungen"
Aus
der Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrunderts sind im
Landesarchiv von Baden-Württemberg "Differenzen
wegen des Rechts zum Salpetergraben in Häusern hohenlohischer
Untertanen zu Gunzendorf ..." belegt. Salpeter war
in der damaligen Zeit nach anderer Quelle ein begehrter Rohstoff, der als
Ausblühung in und unter Gebäuden und Ställen entstand
und dessen Gewinnung vom Landesherrn an Untertanen gegen Abgaben
vergeben wurden, "Der Salpetersieder war deshalb ein
gefürchteter Gast bei den Bauern"
Auch ist die "Beschwerde des Leonhard Mack, hohenlohischer
Schultheiß zu Gunzendorff, und des Johann Leonhard Ballmann
namens aller hohenlohischer Untertanen zu Gunzendorf über die
Abtretung ihrer Steuerpflicht an das preußische Amt
Kolmberg" aus dem Jahr 1792 dokumentiert.
|
Gunzendorf (1856).
Gemeindevorsteher: Georg Horn.
Gunzendorf, Dorf, 4 3/8 St.
von Leutershausen, protest. 29 Häuser, 35 Fam. , 146
Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 1 Schreiner, 2
Weber, 1 Maurer, 1 Schmied, 1 Schuhmacher, 1 Wagner.
Aidenau, Weiler, 4 3/4 St. von
Leutershausen, protest. 15 Häuser, 17 Familien, 90 Seelen. 1 Wirth.
Neumühle, Einöde 4 5/8 St.
von Leutershausen, protest. 1 Haus, 1 Fam., 5 Seelen. Zur Pfarrei und
Schule Geslau.
Steinach, Weiler, 4 1/2 St. von
Leutershausen, protest., 9 Häuser, 12 Fam., 50 Seelen. Zur Pfarrei
und Schule Geslau. 1 Schmie, 1 Weber.
Quelle:
Vetter, Eduard: Statistisches Hand- und Adreßbuch von
Mittelfranken im
Königr. Bayern. Mit höchster Bewilligung aus amtlichen
Quellen
bearbeitet. Ansbach, 1856 (Bayerische
Landesbibliothek ONLINE)
|
Die
unterschiedlichen Besitzverhältnise machen sich in der Flur
bemerkbar.
Während im Süden von Gunzendorf durch das Realteilungsrecht
entstandene
Langstreifenfluren zu erkennen sind, sind die Felder im Norden
von
Gunzendorf größer und haben den Charakter von
Blockfluren.
Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass es sich bei den an
verschiedenen Orten mit "Signale" bezeichneten Anlagen um Teile eines
optischen Telegraphensystems handelt, teilte das Landesamt
für Digitalisierung , Breitband und Vermessung mit, dass
"die
mit "Signal" bezeichneten Symbole stellen Trigonometrische Punkte der
I. oder II. Ordnung dar. Diese waren meist auf Kirchtürmen zu
finden, im vorliegenden Fall wohl Holztürme. Der Geodät, der
im Felde die Terrainaufnahme vornahm, stellte an all diesen markanten
Punkten seinen Messtisch auf und vermaß das umliegende
Gelände."
|
|
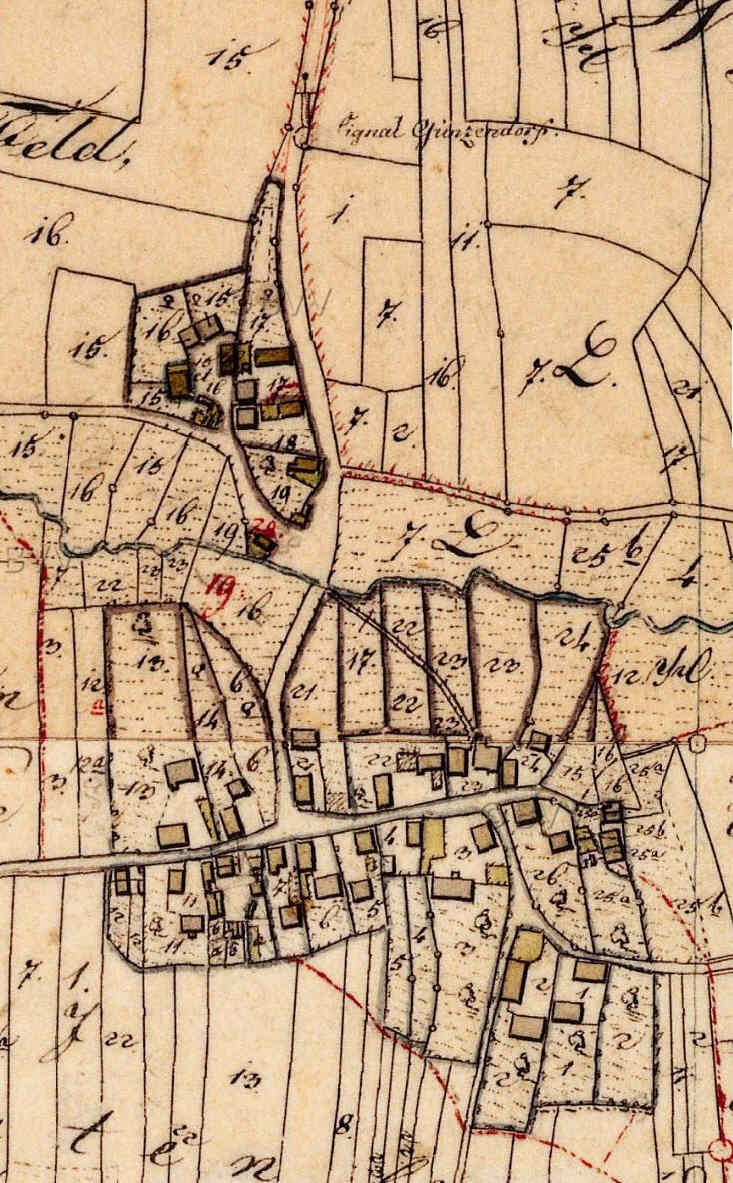
|
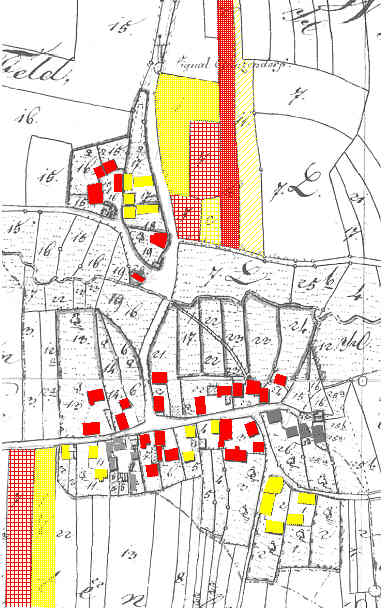
|

|

|
 |
Die Allee nördlich von
Gunzendorf, die offensichtlich mit dem Ausbau der Hutstraße um
1910 angelegt wurde.
|
Neben einem mittelalterlichen
(Quelle: ) Steinkreuz nördlich von Gunzendorf steht auch eine
Tafel der kommunalen Allianz "Obere Altmühl", die von einem
weiteren Unglück an dieser Stelle berichtet:
" Historische Steinkreuze kann
man in dieser Region noch häufig vorfinden In füheren Jahren
wurden Steinkreuze oft als Sühnekreuze für heimtückisch
begangene Morde oder auch als Gedenkkreuze für tragische
Unfälle aufgestellt. ( siehe auch ...
An dieser Stelle ist im
Frühjahr des Jahres 1910 der Hausmetzger und Viehhändler
Michael Kallert aus Gunzendorf HausNr. 5 mit einem Pferdefuhrwerk
verunglückt. Herr Kallert ist infolge dieses Unfalls am 28.
März des Jahres 1910 an Wundbrand (Tetanus) verstorben.
Die Hutstraße wurde 1910
gebaut. Jeder Anlieger musste einen Teil des Weges ausbauen. Die
Untglücksstelle hätt von Herrn Kallert ausgebaut werden
müssen. Dazu ist es wegen des Unglück nicht mehr gekommen. "
|
|
Heutiger
Ortsteil Hürbel
|
Huerbel (1799-1804),,
Weiler mit 10 in das ehemalige Oberamt Ansbach gehoerigen Unterthanen.
|
|
Heutiger Ortsteil Kreuth
|
Kreuth (1799-1804),,
Weiler mit 14 in das ehemalige Ansbachische Oberamt Colmberg
gehoerigen Unterthanen.
|
|
Heutiger Ortsteil Lauterbach
|
Lautenbuch
(1799-1804),,
nach der Vetterischen Karte Lauterbach
Weiler mit 11 in das Ansbachische Oberamt Colmberg gehoerigen
Unterthanen.
|
|
Heutiger Ortsteil Oberbreitenau
|
Oberbreitenau
(1799-1804),,
Weiler mit 8 in das Ansbachische Oberamt Colmberg gehoerigen Unterthanen
Aus dem
1809, also nach dem Übergang des Gebietes an Bayern sind "Forderungen
der bayerischen Kommunen Rothenburg und Ober- und Unterbreitenau an das
Amt Gebsattel; Arrestblegung des auf bayerischem Gebiet liegenden
Zehnten des Amts Gebsattel" belegt.
|
|
| Heutiger Ortsteil Oberndorf |
Oberndorf
(1799-1804),,
Weiler, mit 19 in das Ansbachische Oberamt Colmberg gehoerigen
Unterthanen.
|
|

Neben der
tragischen Geschichte liefert die Überlieferung einen Hinweise auf
die Verarbeitung von Wolle oder Leinen, denn von der wilde Karde, die
auch in unserer Gegend wächst, wurden die stacheligen
Blütenköpfe früher von Webern zum Bürsten von
Wollstoffen benutzt. Dien Vorgang, der heute maschinell
durchgeführt wird, nennt man aber noch immer kardieren.

"Wilde
Karde" von Rosa-Maria Rinkl (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
|
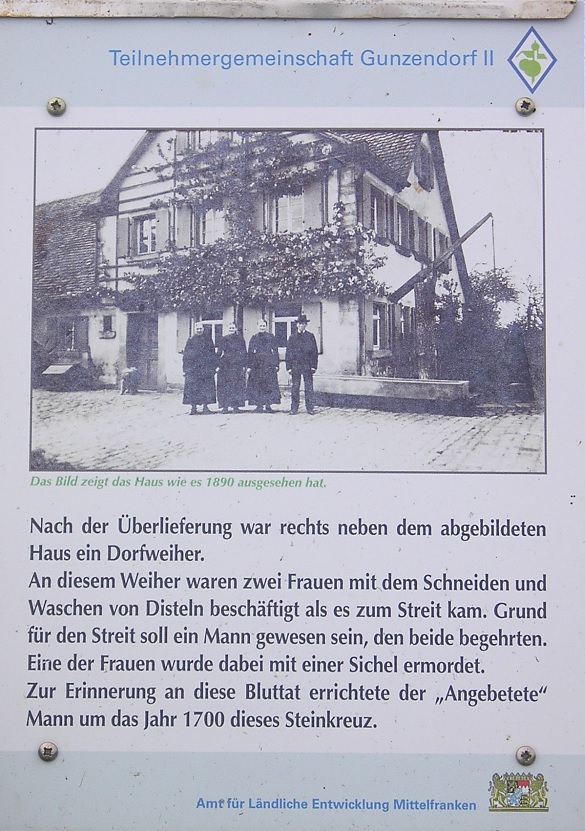
|
Heutiger Ortsteil Reinswinden
|
 Im Zeitraum von 1620 - 1623 ist der
Verkauf des seckendorffischen Hofes in Reinswinden
belegt. Im Zeitraum von 1620 - 1623 ist der
Verkauf des seckendorffischen Hofes in Reinswinden
belegt.
Die ehemals seckendorffischen Höfe in Geslau waren
schon im 14. Jahrhundert veräußert worden (siehe
Mittelalter)
Informationen zu Familie Seckendorff
Reinswinden (1799-1804),,
Weiler; 3 Unterthanen sind Ansbachisch und gehoeren in das Oberamt
Colmberg. 4 hingegen sind ritterschaftlich.
|
|
Heutiger Ortsteil Schwabsroth
|
Schwabsroth (1799-1804), ,
Weiler mit 12 Ansbachischen in das Amt Colmberg gehoerigen Unterthanen.
|
|
Schwabsroth.
(1856)
Gemeindevorsteher:
Michael Lang von Reinswinden.
Schwabsroth,
Weiler, 3 1/2 St. von Leutershausen, protest. 14 Häuser, 18 Fam.,
75 Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 18 Fam., 75
Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 1 Essigfabrik, 1
Weber, 1 Büttner, 1 Wagner.
Lauterbach, Weiler, 2 3/8
St. von Leutershausen, protest. 17 Häuser, 19 Fam., 105 Seelen.
Zur Pfarrei und Schule Buch am Wald.
Oberbreitenau, Weiler, 4
1/4 St. von Leutershausen, protest. 11 Häuser, 14 Fam., 68 Seelen.
Zur Pfarrei und Schule Kirnberg. 1 Essigfabrik, 1 Koch, 1 Weber, 1
Metzger, 1 Weinwirth, 1 Zimmermeister.
Oberndorf, Dorf, 3 St.
von Leuterhausen, protest. 21 Häuser, 22 Fam., 102 Seelen. Zur
Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 1 Schmied, 3 Weber.
Reinswinden, Weiler,
3 1/4 St. von Leutershausen, protest. 17
Häuser, 18 Fam., 50 Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau
|
|
Heutiger Ortsteil Steinach am Wald
|
Steinach am Wald
(1799 -
1804)
oder auf dem Wald, koeniglich Preußischer Weiler an der
Rothenburgischen Landesgrenze, gegen Colmberg, von vier Gemeindrechten,
worunter die Rothenburgischen vogtbaren Unterthanen 6 Dienste thun und
2 Wagen stellen. Der Ort ist nach Geßlau eingepfarrt und
entrichtet den Zehnten in das Kammeramt Colmberg und nach Herrieden.
Steinach am Wald (1856)
siehe Gunzendorf
|
|
Heutiger Ortsteil Stettberg
|
Stettberg (1799-1804),
eine Stunde von Colmberg, ein an der Bayreuthischen Graenze, 3 Stunden
oberhalb Aurach gegen Norden an einem von Windelsbach herabkommenden
Bache, der oberhalb Meuchlein in die Altmuehl fällt, gelegenes und
von Binzwang durch einen dazwischen liegenden Berg getrenntes Pfarrdorf
von 15 Unterthanen, wovon einer Eichstättisch und zwar zum
oberlaendischen Ober- und Vogtamte Wahrber-Aurach gehoerig ist.
Siben sind Rothenburgisch, die 6 Dienste haben und 2 Wagen stellen.
Jeder Unterthan ist seiner Herrschaft vogt- und schatzbar. Die hohe
fraischliche Obrigkeit ist seit 1525 Brandenburgisch.
|

|
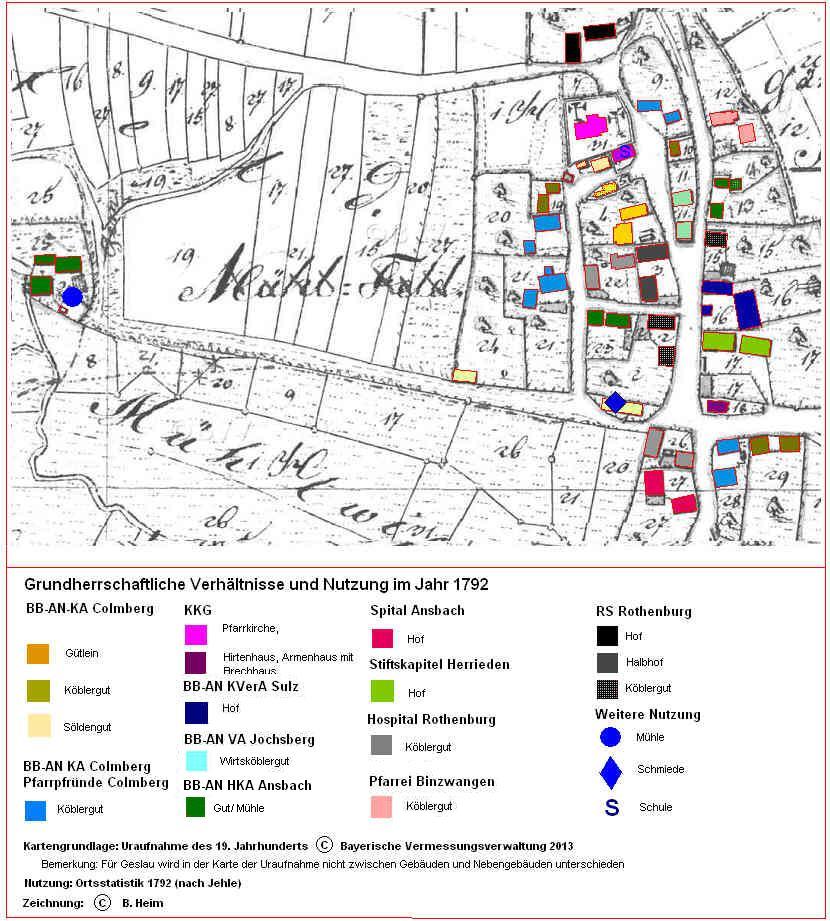
Der Urpsrung
der Grundherrschaft über den zum Spital Ansbach
gehörigen Hof dürfte eine mitelalterliche Stiftung an
das Gumbertuskloster in Ansbach sein (vgl. Kapitel von der Zeit der
Kelten zum Mittelalter). Das Stiftskapitel Herrieden verfügte über
Zehnteinnahmen aus einem Gebiet weit verzweigt Deutschland bis
Österreich.
|
Stettberg. (1856)
Gemeindevorsteher: Michael Stark.
Stettberg,
Kirchdorf, 3 3/4 St. von Leutershausen, protest. 35 Häuser, 40
Fam., 163 Seelen. Mit eigner Schule; Filial zur Pfarrei Binzwangen. 2
Wirthe, 1 Mühle, 1 Schmied, 1 Krämer, 1 Schreiner, 1 Weber, 1
Büttner, 2 Schneider, 2 Schuster.
|
|
Heutiger Ortsteil Unterbreitenau
|
Unterbreitenau,
niedrig Bratna, Weiler auf koeniglich Preußischem Territorium,
nahe an der Rothenburgischen Landesgraenze gegen Leutershausen. Es hat
9 Gemeindrechte, welche Rothenburg angehoeren, wohin sie auch vogt- und
schatzbar sind und in dieser Rücksicht 12 Dienste leisten und 3
Wagen stellen die hohe Fraisch ist Brandenburgisch, der Zehnt
Comburgisch. Der Ort ist nach Kirnberg eingepfarrt.
|
|
Die
Gebietsansprüche waren um 1800 noch sehr kompliziert.
Einen
kartographischen Überblick gibt das Projekt "Territorienwelt um 1800" auf den Seiten der
Franconica der Universitätsblibliothek Würzburg
Im Jahr 1796 schloss das preußische Fürstentum Ansbach mit
den Nachbarterritorien Verträge über Grenzbereinigungen. Dies
umfasste sowohl das Territorium als auch die Untertanen
Mit der Bildung der Königreiche Bayern (1806) und
Württemberg wurde das Fürstentum
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst aufgelöst. Die
Besitzungen um Schillingsfürst kamen zu Bayern.
|
|

Schloss
Schillingsfürst - Matthäus Merian 1656
|
|
|
|
|
|