|
Historisches
Klima
|
 Was hat Klima mit
Geschichte zu
tun? - Eine
Antwort Was hat Klima mit
Geschichte zu
tun? - Eine
Antwort
|
Bedeutsam für
die Siedlungsaktivität des Menschen, aber auch für die
Erträge der Landwirtschaft sind in historischer Hinsicht in jeder
Klimazone die klimatischen Bedingungen. Kurz-, mittel oder langristige
Schwankungen haben diese beeinflusst. Einer der ersten, die wohl eine
ausführliche Zusammenstellung milder /strenger Winter sowie
trockenheißer Sommer gegeben hat dürfte der
österreichische Astronom und Meteorologe Anton Pilgram (1730 -
1793) gewesen sein. Er wertete schriftlich belegte
historische Quellen aus und wollte für Österreich
meteorologisch Messstation aufbauen (vgl. rechts)
Diese qualitativen Beschreibungen unterliegen allerdings regionalen
Einschränkungen und subjektiven
Bewertungen der jeweiligen Autoren und erlauben nur
eingeschränkt objektive Aussagen, wie
dies auch Glaser ( ) herausstellt.
Erst seit den Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert liegen
verlässlichere Daten vor. Um weiter zurückreichende Quellen
abzusichern verwendet man heute unterschiedliche Methoden (s. unten).
Während die Eisbohrkerne Aussagen über überwiegend
globale (Nordhemisphäre/Südhemisphäre)
Klimaaussagen treffen lassen, können Pollenanalyse m. E. und
dendrochronologische Untersuchungen zwar regionalbezogene
klimatische Entwicklungen beschreiben.
Die
unten dargestellte Kurve wurde überwiegend mittels
Eisbohrkernen aus Grönland gewonnen und kann keine regionalen
Unterschiede angeben. Grob lassen sich wärmere und kältere
Phasen erkennen:
ab
2000 BP
- das
römische Temperaturmaximum
- das
mittelalterliche Maximum von 1100 - 1500
- die
kleine Eiszeit von 1500 bis 1850
|
zum
Originalwerk
Anton
Pilgram
|
|
|

|
|
|

von
Iceage_time-slice_hg.png: Hannes Grobe/AWI derivative work: Alexchris
(Diskussion) (Iceage_time-slice_hg.png) [CC BY 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons.
http://ieg-ego.eu/de/threads/hintergruende/natur-und-umwelt/atmosphaere/ruediger-glaser-historische-klimatologie-mitteleuropas
https://www.tambora.org/index.php?r=site/index
Landwirtschaft
und Klimawandel in historischer Perspektive - Bundeszentrale für
pol. Bildung
|
Extremereignisse,
die außer thermischen und hygrischen Verhältnissen auch die
Art der
Niederschläge, Hochwasser und weitere witterungsbedingte
Phänomene regional bezogen wiedergeben, sind fast
ausschließlich durch historische Überlieferung erfasst.
Glaser (2001) setzte mit seiner "Klimageschichte Mitteleuropas", die
auf seiner Datenbank HISKLID basierte, einen vielbeachteten neuen
Ansatz zur Rekonstruktion des Klimas Mitteleuropas von 1000 bis 2000
unserer Zeitrechnung .
Seit 2014 steht die Datenbank
HISKLID nun auch im Netz zur Verfügung.
Alleine für den Raum um die westliche Frankenhöhe sind
mehrere tausend Quellen mit ihrem Originaltext angegeben:
- Ansbach 15
- Rothenburg
1670
- westlich
Frankenhöhe ca. 50
- Bad
Windsheim 2678
Aus dieser
Vielzahl von Ereignissen, die zu einer regionalen Klimageschichte im
Rahmen einer Ortsgeschichte,
beitragen könnte, soll nur eines wiedergegeben werden, da hier
Orte genannt sind, die zu Geslau gehören :
|
Hochwassermarken in
Wertheim
(von Rainer Lippert, bearbeitet durch Cornischong (Eigenes Werk) [CC0],
via Wikimedia Commons)

Hochwasser
in Würzburg 1784
|
|
Die Chronik des
Marktes Burgbernheim (links) beschreibt
eindrucksvoll die wechselvoll Klimageschichte am Rand der
Frankenhöhe.
|
a
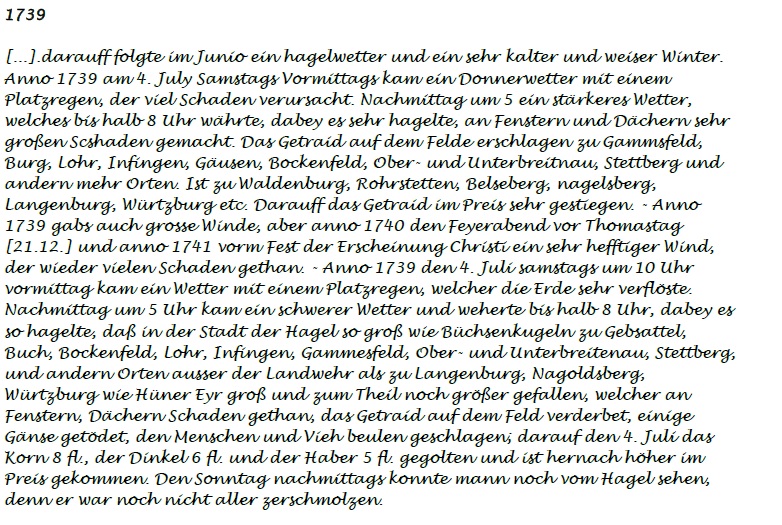
|
Für
weitere Quellen soll auf die Datenbank Datenbank
HISKLIDverwiesen werden.
Auswertung der HISKLID-Quellen für Rothenburg ob der Tauber
Sturmschäden auf der Frankenhöhe in den 1990-er Jahren |
untenstehende
Zusammenstellung lässt sich vergrößern
|
Einige
Zitate:
|
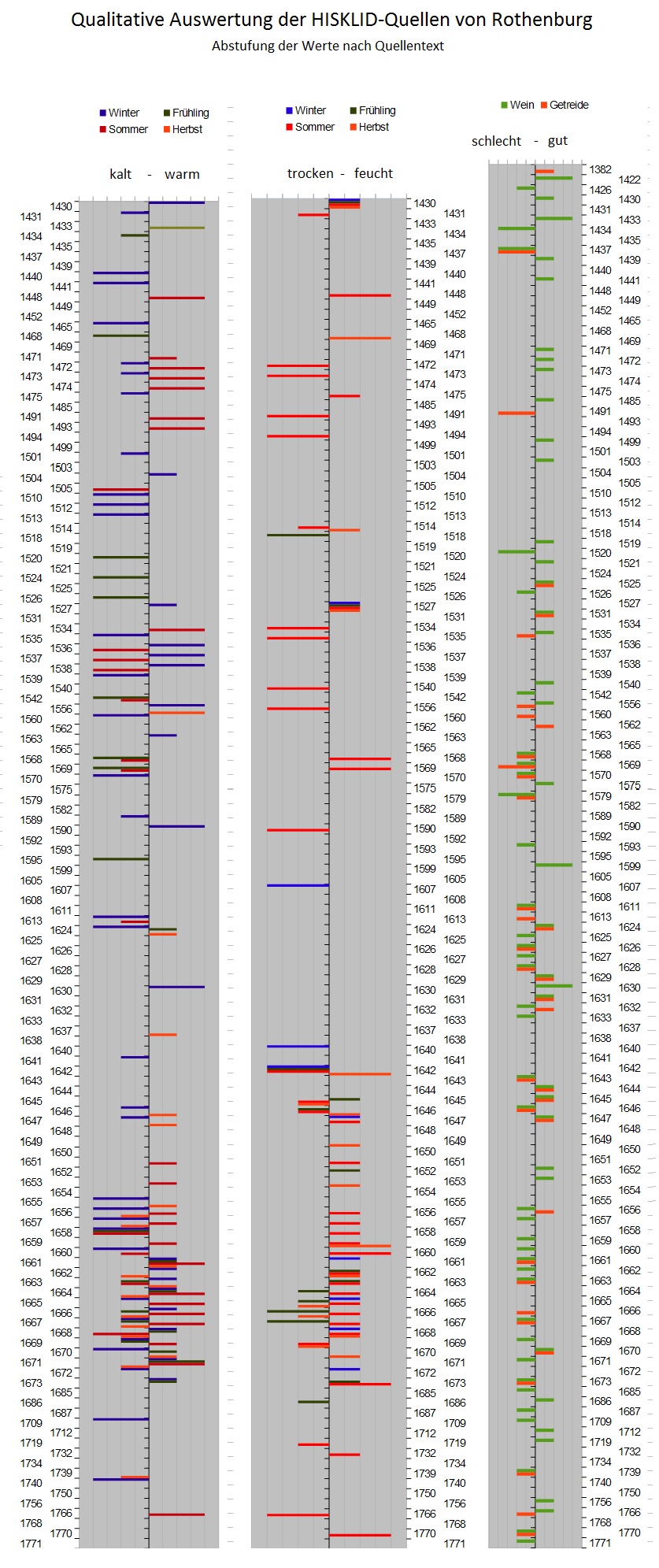 |
|
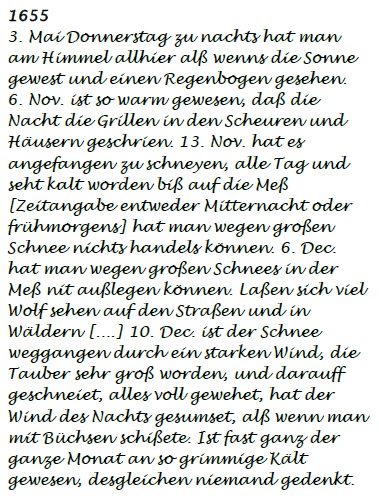
|
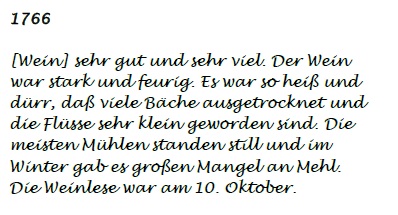
|
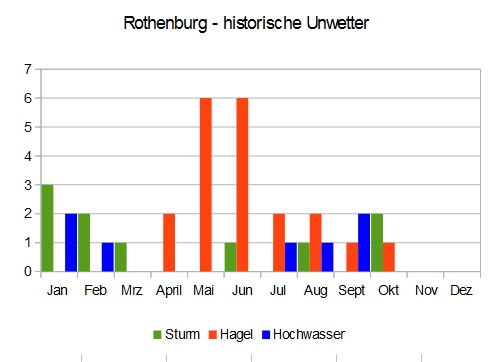
|
|
Sturm
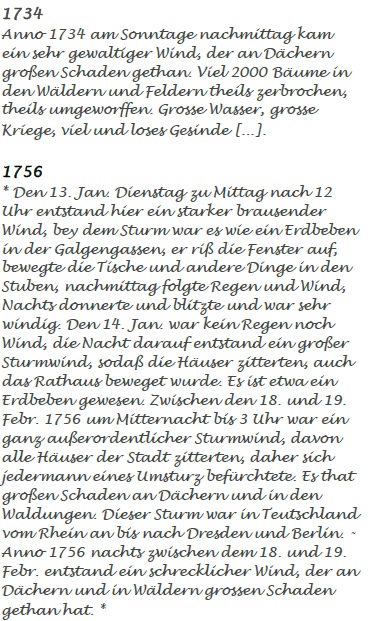
Hagel
Hochwasser
|
|

Bildquelle: von Rainer Lippert
(DWD, own painting, used EXCEL) [Public domain], via Wikimedia Commons
Es fällt auf, dass die
Zeiträume, in denen Temperaturwerte mit Erntestatistiken
verknüpft wurde in Perioden fallen, die kühlere
Zeiträume innerhalb der ausklingenden kleinen Eiszeit
umfasen: 1805, 1830 - 1840, 1854
Die Ursachen dieser kleineren Schwankungen sieht man in den
atmosphärischen Folgen von Vulkanausbrüchen, wie z. B. die
des Tambora
im Jahr 1815,
die aber für die Nahrungsmittelproduktion erhebliche Folgen hatte.
(vgl. "Jahr ohne Sommer" als Folge des
Tambora-Ausbruchs)
|
|
|
|
Das
Wetter in der Region in den Jahren von 1827/28 bis 1841/42 - Vergleich
mit heute
|
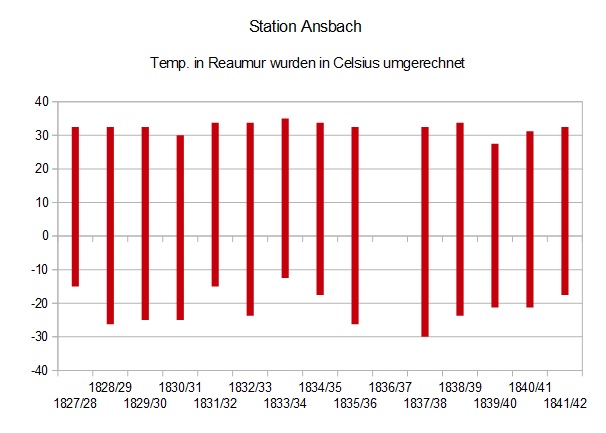 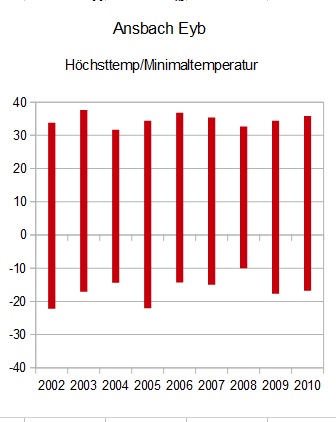
|
Von den 14 Jahren,
die mit den absoluten Temperaturmaxima und -minima erfasst wurden,
hatten 9 Jahre eine Tiefsttemperatur von - 20°C und darunter.
Das Jahr 1837 mit -30° war das kälteste. Vergleicht man die
Minimaltemperaturen mit denen von der Reihe von 2002 bis 2010, so liegt
die hinsichtlich der Anzahl deutlich darüber, die der Absolutwerte
deutlich darunter. In den Sommerjahren von 1827 -
1841 lagen die Maximalwerte der Temperaturen zwar fast in jedem Jahr
über 30° C, aber deutlich unter den Maximalwerten der Reihe
von 2002 - 2010.
Bezieht man den Witterungsverlauf mit ein, so erkennt man, dass in den
Jahren von 1829 bis 1841 das Frühjahr fast durchweg zu kalt war,
im Jahr 1832/33 trat selbst im August noch Frost auf, im Frühjahr
oft nur geringe Niederschläge fielen und der Sommer meist trocken
war. Dies hatte gewaltige Auswirkungen, denn die Landwirte waren
auf ihre Brunnen, die oftmals auch versiegten und wenn
möglich Wasser aus den Flüssen und Bäche angewiesen,
also auf oft weit entfernte Wasserstellen, sofern diese nicht auch
Niedrigwasser führten oder versiegt waren.
(Jahrbuch der
Stadt Ansbach 1835/36) " [...] Der Sommer war sehr
warm
und besonders trocken, doch gab es nur wenige warme Nächte auch
nur
sehr wenige Gewitter, daher fortwährender Wassermangel, besonders
an
Mahlwasser [... ] dagegen blieb
die Sommerfrucht sehr
zurück, indem dieser die anhaltende Dürre des Sommers
schadete. Die
Heuerndte fiel zwar ergiebig aus, nicht aber diejenige des Ohmen, auf
welcher die Dürre und Heuschrecken sehr nachtheilig wirkten."
|
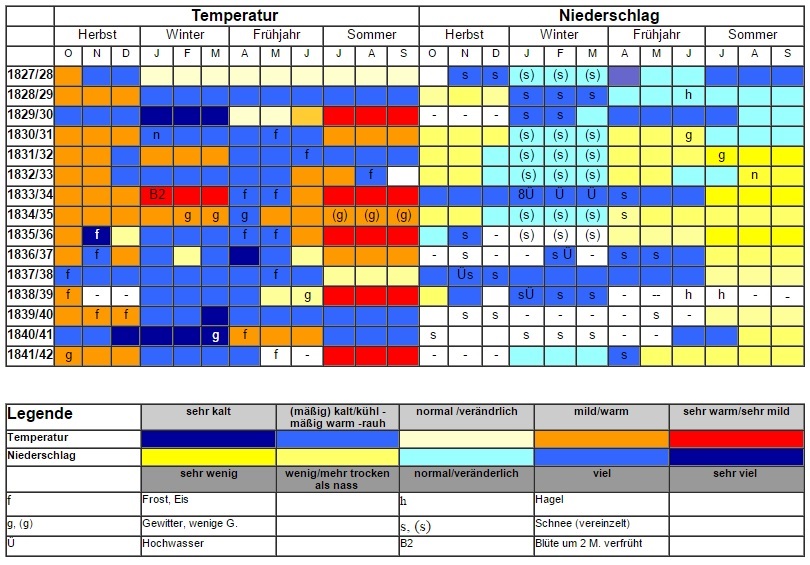
|
|
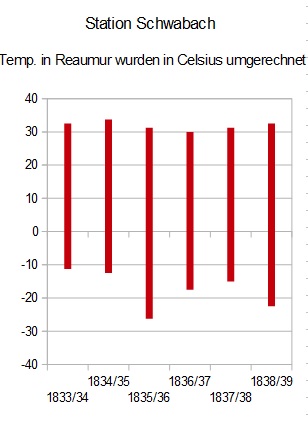 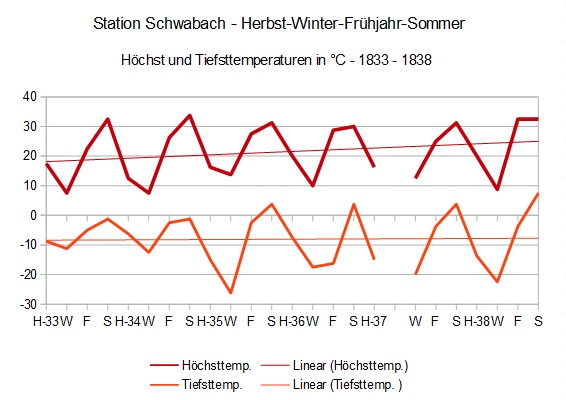
|
Folgen
aus den Wetterverhältnissen für die Jahre 1827/28 bis 1841/42
Wortbeschreibung
der Erntemengen in den Jahrbüchern der Stadt Ansbach
|
1827/28
|
Im Allgemeinen
läßt
sich die
Fruchtbarkeit in diesem Jahre als mittelmäßig bezeichnen.
Die
Wintersaat war sehr schön, aber die veränderliche Witterung,
welche
beinahe das ganze Jahr hindurch herrschte, wirkte nachtheilig, so wie
sie auch der Erndte ungünstig war.
|
1828/29
|
[…] Das Jahr 1828/29
war ein sehr
fruchtbares Jahr. Der ziemlich kalte Frühling hat jedoch die
Vegetation etwas zurückgehalten, besonders das Gras, so daß
die
Heuerndte nicht ganz ergiebig ausgefallen ist; von Grummet, welches
wegen anhaltenden Regenwetters nicht gut gedürrt werden konnte,
verlohr ein Theil an Güte. Es gab in dessen ungewöhnlich viel
Kartoffeln und Kraut. Das Hagelwetter, welches am 28. Juny 1829 auf
seinem Zuge von Süden nach Norden einen Teil der Flur traf,
|
1829/30
|
[…]
Wenn gleich der
Winterbau gering
ausgefallen ist, was der nassen Saatzeit und dem darauf gefolgten
sehr strengen Winter zugeschrieben werden muß, so ist dagegen der
Sommerbau desto ergiebiger gewesen, und kann zum größeren
Theile
sehr gut gerathen erklärt werden. Erdäpfel und Rüben
sind in
geringerer Quantität und Qualität gewachsen, da hierauf die
nasse
Witterung, welche einige Zeit bestund, starken Einfluß hatte. Heu
und Grumet hatten vorzügliches Wachsthum, doch hat das Heu durch
das
Regenwetter etwas an Güte verloren.
|
1830/31
|
|
1831/32
|
Auch der Sommer war
kühl und noch in
der Nacht des 23. Juny erfroren die Erdbirnkräuter. Zugleich
herrschte große Trockenheit, so daß starker Wasermangel
für die
Mühlen eintrat und Mehl aus entfernteren Gegenden herbeigeschafft
werden mußte.
|
1832/33
|
Des Sommers Anfang
war freundlich und
warm, bald aber wurde die Witterung veränderlich und kühl,
blieb
jedoch mehr trocken als naß; es regenete zwar sehr oft, aber
selten
viel, daher der Wasserstand niedrig blieb. In der Nach vom 7. auf dem
8. August trat noch solche Kälte ein, daß an tiefen Stellen
die
Erdbirn- und Gurkenblätter erfroren. Wegen der starken Trockenheit
wurden die Früchte früher reif und schon in der Mitte des
Juli
begann die Erndte; am 20. Juli kam das erste neue Korn in die
Schranne und die ersten frischen Erdbirnen wurden auf den Markt
gebracht.
|
1833/34
|
Der Sommer war
ungewöhnlich warm und
trocken, bsonders weil es nur wenig und meistens entfernte Gewitter
gab, die selten Regen brachten. Alles reifte deshalb auch früher,
so
daß an der Kirchweihe den 4. August 1834 schon reife Trauben auf
den
Markt kamen, auch bis Ende August dahier in den Gärten reife
Trauben
sich zeigten
|
1834/35
|
Zwar ließ das
Frühjahr
ein
ausgezeichnetes Erndtejahr hoffen, aber die eingetretene anhaltende
Trockene vereitelte diese Hoffnungen größtentheils. Denn
wenn
gleich die Winterfrucht ziemlich ergiebig und namentlich mehlreich
ausgefallen ist, so wurden doch die Sommerfrüchte, insbesondere
Erdbirnen und Rüben im Wachsthum und in der Ausbildung
zurückgehalten. Das Ohmet litt so, daß manche Wiesen gar
nicht
gemäht werden konnten. Die später eingetretenen Regen
begünstigten
zwar eine gute Herbstweide, allein die bald eingetretenen Kälte
brachte auch hierin wieder Nachtheil.
|
1835/36
|
Die Aussichten im
Frühjahre
waren gut,
die Winterfrucht war sowohl nach der Garbe als nach Körnern
Ergiebig; dagegen blieb die Sommerfrucht sehr zurück, indem dieser
die anhaltende Dürre des Sommers schadete. Die Heuerndte fiel zwar
ergiebig aus, nicht aber diejenige des Ohmen, auf welcher die
Dürre
und Heuschrecken sehr nachtheilig wirkten.
Um die
Beförderung des
Hopfenanbaus
[…] Der Hopfen scheint in hiesiger Flur zu gedeihen und zeigt sich
von besonderer Güte.
|
1836/37
|
Die
Witterung war
dem Feldbau günstig, nur litt das Grummet in Folge stattgehaber
Überschwemmungen in den Wiesengründen etwas
|
1837/38
|
Wenn
gleich etwas
geringer als im vorigen Jahre wäre die Erndte doch sehr gut
ausgefallen, wenn nicht die Witterung zu lange kühl gewesen
wäre,
wodurch die Getraideähren in ihrer innern Ausbildung
zurückgehalten
worden sind, woraus folgte, daß die Körner zähe wurden
und beim
Mahlen mehr Kleie und um so weniger Mehl gaben.
Dam
Hopfen war die
Witterung nachtheilig, so daß, gegen voriges ahr bei gleichem
Anbau,
nur dieHälfte erzielt werden konnte.
|
1838/39
|
In
diesem Jahre
würde es durchaus eine gesegnete Erndte gegeben haben, wenn nicht
der Wetterschlag großen Schaden angerichtet hätte. Obt gab
es fast
gar nicht, Heu und Ohmed hingegen in Qualität und Quantität,
vorzüglich ebenso Erdbirnen.
|
1839/40
|
Die
Fruchtbarkeit
war dieses Jahr ausgezeichnet. Heu und Ohmed ertrugen die Wiesen
gegen frühere Jahre wegen der im Frühjahr schon stattgehabten
und
auch im Sommer noch fortgedauerten Trockene, weniger, aber desto
kräftiger wurde das Futter.
Der
Hopfenanbau
gedieh heuriges Jahr nicht zum Besten. Ein bösartiger Thau war
aller Wahrscheinlichkeit nach die Veranlassung, daß er
größtentheils
schwarz geworden ist.
Obstbau
war heuer
ersprießlich, doch zeichnet er sich in hiesiger Gegend nicht aus,
weil der Boden zum Getraidbau verwendet wird und aus der
Frankengegend Obst in großer Menge zum Verkauf kommt.
Seidenbau.
Dieser ist ganz eingegangen. Nachdem Neumeier sich von hier entfernt
und nach Amerika begeben hatte, blieben seine Maulbeer-Anlagen und
Einrichtungen zur Seidengewinnung müssig stehen.
|
1840/41
|
Die
Fruchtbarkeit
war gut. Wären im Winter die Felder nicht allzulange ohne Schnee
geblieben, wodurch der Saame zu frei den und Frost ausgesetzt war, so
daß viele mit Winterfrucht bebaute Aecker verdorben sind und zur
Bebauung mit Sommerfrucht umgeacker werden mußten, so hätte
eine
ausgezeichnete Aerndte statt finden können, inzwischen hat sich
doch
die auf den umgeackerten Feldern eingesäte Sommmerfrucht sehr
ergiebig gezeigt. Wiesenertrag war gegen das Vorjahr sehr gut. Der
Hopfen war wieder nicht besonders ergiebig, weil vie davon blind
geblieben ist oder sich nicht gehörig ausgedollt hat. Obst gedieh
vorzüglich.
|
1841/42
|
Der
Winterbau war
ziemlich gut; die Sommerärndte hingegen ist in Folge der vom
Frühjahr bis zum Herbst anhaltend statt gehabten Trockene ganz
gering ausgefallen. Die Heu- und Ohmedärndte war ganz schlecht und
würde nicht der Herbst noch anhaltend gute Witterung gespendet
haben, welche eine lange anhaltende Herbstwaide gestattet hat, so
wäre für den Vieh- und damit auch für den Nahrungsstand
eine noch
größere Noth entstanden, als sie wirklich sich ergeben hat.
Bezüglih
der
Erdbirnen war die Witterung sehr nachtheilig, indem die Trockene
ihren Wachsthum zurück hielt
Beim
Hopfenbau
waren mehr einige stattgehabte bösartige Thaue als die Trockene
Ursachen der geringen Ergiebigkeit; das Obst hat in Folge der
ungewöhnlich starken Trockene an Ertrag und Güte
sehr gelitten.
|
Rückgang
der Erntemengen Graphische Umsetzung der Erntemengenangaben aus den
Jahrbüchern der Stadt Ansbach
Die
graphischen Umsetzungen zeigen, dass sich die Ertemengenentwicklung in
den 30-er Jahren des 19. Jahrhunderts dramatischer
gestaltete als die Wortbeschreibungen oben wiedergeben.
|
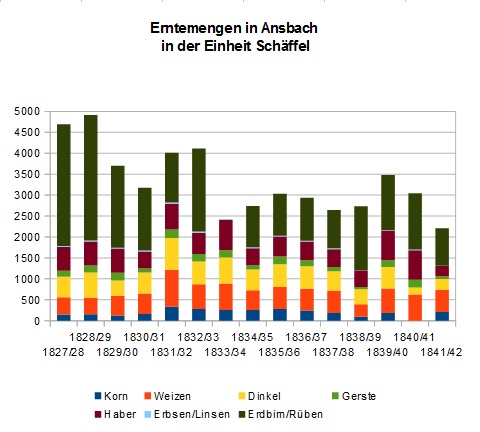
|
Die
Erntemengen werden für Getreidearten in den Quellen sowohl in
Schober als auch in Schäffel angegeben. Die Einheit Schober
bezieht sich auf das ungedroschene Getreide (1 Schober = 60 Bund/Garben Stroh). Diese
Einheit lässt sich nicht absolut definieren, war aber im 19.
Jahrhundert wegen der nötigen Einstreu aber auch als Baustoff in
Verbindung mit Lehm wichtig.
Da
Schäffel ein Raummaß, ist, das im 19. Jahrhundert starken
regionalen Unterschieden unterworfen war und keine sinnvolle Umrechnung
in der zur Vefügung stehenden Literatur gefunden wird die Einheit
des Ansbacher Schäffel verwendet. Darüberhinaus ist eine
direkte Umrechnung in Gewichtseinheiten nur bei Kenntnis des
unterschiedlichen spezifischen Gewichts der einzelnen Fruchtarten
möglich. Hopfen, Klee und Heuerntemengen dagegen sind in Centner
angegeben.
Bis zum Jahr
1835/36 wurden die Flächenmaße in „Alt Ansbacher Morgen“
angegeben, ab dem Jahr 1836/37 in „Bayerischem Morgen“. Da auch hier
keine sinnvolle Umrechnung zur Verfügung stand, wurden die Angaben
der folgenden Jahre in „Alt Ansbacher Morgen“ durch Interpolation
mittels des Verhältnisses der Gesamtflächen 1835/36 und
1836/37 umgerechnet
Im Vergleich
zu den beiden Jahren Ende der 20-er Jahre des 19. Jahrhunderts gehen
die Gesamterträge bis zum Jahr 1841/42 mit Schwankungen auf knapp
die Hälfte zurück. Besonders stark sind die
Erntemengenrückgänge bei Rüben und Kartoffeln, die eine
wesentliche Grundlage der Ernährung für die ländliche
Bevölkerung und als Futter für die Schweine bilden. Im Jahr
1833/34 fällt die Ernte von Kartoffeln und Rüben fast
vollständig ausgefallen.
|
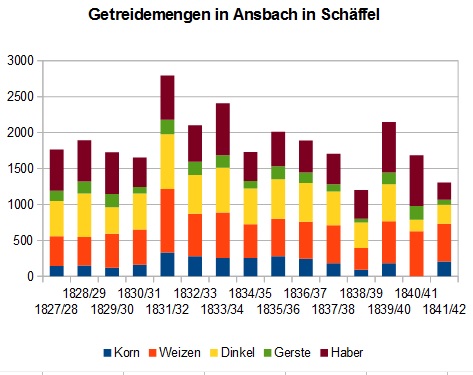
|
Von
der Mitte der 30-er Jahre bis zum Anfang der 40-er Jahr des 19.
Jahrhunderts sind die Gesamterträge nur halb so hoch, teilweise
nur ein Drittel der Erträge Ende der 20-er Jahre. |
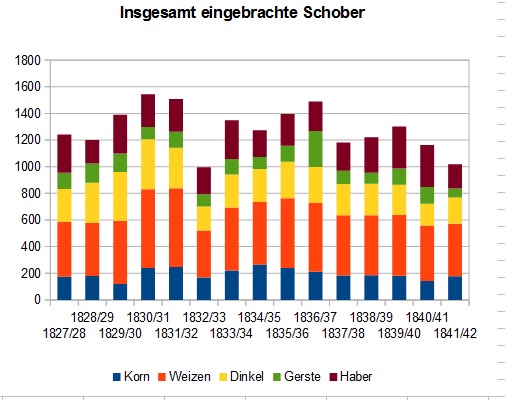
|
|
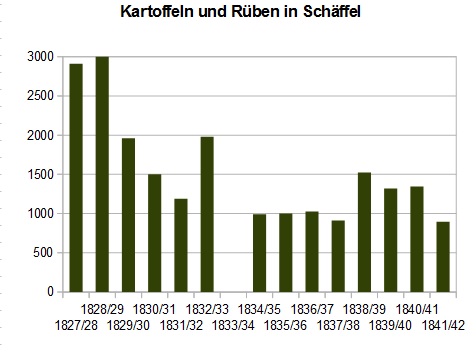
|
Waren die
Erträge an Kartoffeln und Rüben Ende der Zwanziger Jahre sehr
hoch, so betrugen dies ein den Dreißer Jahren nur ein Drittel bis
zur Hälfte davon. Im Jahr 1833/34 fiel die Kartoffelernte sogar
fast vollständig aus.
|
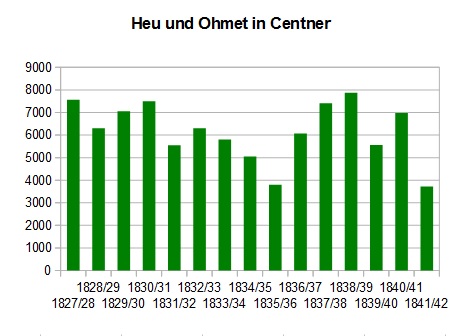
|
Auch
das Heu und das Ohmet (zweiter Schnitt) als Viehfutter ist
großen, maximal 50%-igen Schwankungen zum Maximalwert
unterworfen. |
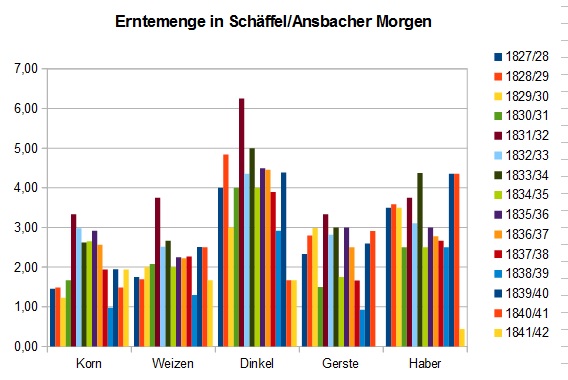
Die
höchsten Erträge je Flächeneinheit erbrachte bei den
Getreidearten stets der Dinkel, der heute kaum noch vertreten,
bzw. wieder häufiger im Rahmen des biologischen Feldbaus
vertreten ist. Trotzdem nehmen alle Getreidearten
hinsichtlich der Erntemenge an Körnnern im betrachteten Zeitraum
auf die Hälfte bis zu einem Drittel des Maximalwertes ab.
|
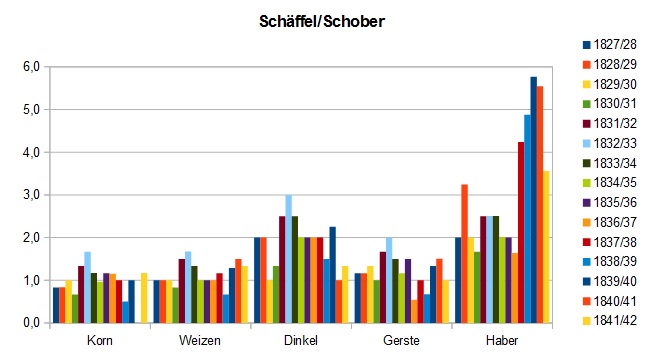
Der
Vergleich
Schäffel je Schober kennzeichnet je Getreideart die Qualität
der Kornbildung. Insbesondere der Hafer scheint hinsichtlich der
Kornbildung die Witterung der Jahre 1840/41 und 41/42 zu lieben.
Während
Roggen, Weizen und Gerste niedrigere als die Maximalwerte im Jahr
1832/33 aufweisen, besitzt die Gerste ihre maximalen Erträge im
Jahr 1839/40
Einsetzende
Auswanderung nach Nordamerika Mitte der 30-er Jahre
Während
die Jahrbücher der Stadt Ansbach bis Mitte de 30-er Jahre
nur vereinzelte Auswanderungen nach Österreich, Württemberg
und Preußen beschreiben setzt ab der Mitte der 30-er Jahre die
Auswanderung nach Nordamerika ein:
„Ausgewandert: zwei Personen nach
Oestreich, zwei nach Preußen, vier nach
Würtemberg, eine nach Sachsen, zwei
nach Baden, eine in die Schweiz, und dreizehn Personen nach
Nordamerika, nämlich zwei Familien von 9 und drei Köpfen,
dann eine
ledige Person, von denen aber ein Familienvater mit Frau und Kind
wieder nachdem er den größten Theil seines Vermögens
zugesetzt
hatte, zurückgekommen ist.
[...]
Im
Kapitel
Zu- und Abwanderung sind für einzelne Orte der
Frankenhöhe Name und Stand von Auswanderern zusammengestellt.
Neben diesen klimatischen Ursachen sind aber auch gesellschaftliche
Faktoren verantwortlich wie die Ablösung des Zehntes, der für
zahlreiche Landwirte ein Problem war oder die wirtschaftliche und
soziale Situation des Gesindes (vgl. auch Kapitel Landwirtschaft
im 19. Jhd)
|
|
|
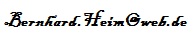
|
|
|
|
|
|