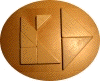Romantik, Vormärz, Realismus ...
K. Dautels Ideen, Materialien und Vorschläge für den Deutschunterricht
Die Materialien stehen unter der Creative Commons Lizenz: CC BY 4.0.
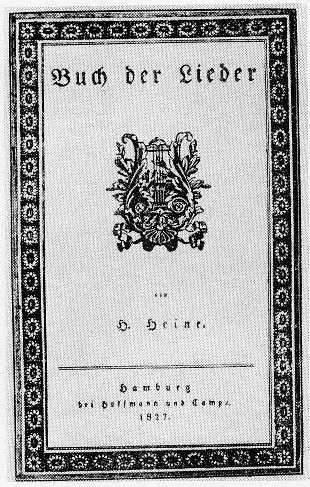

ist eine Gesamtausgabe von Heines bis dahin bereits veröffentlichten Gedichten.
Sie entsprang dem jugendlichen Ehrgeiz Heines, dass seine Gedichte "so populär werden wie die Bürgerschen, Goetheschen, Uhlandschen"(1826). Das literarische Vorbild war Goethes „West-östlicher Divan". Das >Buch der Lieder< ist in Gedichtzyklen organisiert, die weitgehend der Ordnung der bisherigen Veröffentlichungen entsprechen.
Der PUBLIKUMSERFOLG war zuerst gering:
2000 Exemplare in 10 Jahren. Das bürgerliche Publikum konnte mit der Mischung aus Romantik und Frivolität wenig anfangen. Das ironisch-leichte Spiel mit romantischen Sentiments und lyrischen Formen behagte ihm nicht, man vermisste die Ernsthaftigtkeit und echte Tiefe des Gefühls.
Heines Verleger Julius Campe schreibt ihm 1833:
"Wenn Sie Uhlands Gedichte betrachten und das Renomme, worin er sich befindet, Religiös und Mittelalterlich, so ist klar, warum er so viele Leser findet. SIE behandeln Liebe und Sich selbst, und wieder Sich selbst, das sehen die Leute als stinkigen Egoismus an (...) der Egoismus wird Ihnen ununterbrochen zur Last gelegt, dann, dass Sie der Üppigkeit das Wort reden. Bedarf es noch mehr Gründe, um zu beweisen, warum Uhlands Gedichte populärer sind. Uhlands Gedichte kauft jeder um ein Geschenk an eine Dame, zum Geburtstag und sonstigen Zwecken zu machen. IHR Buch geht nach den Universitäten an junge Männer und dergleichen - die kein Geld haben." Heine Buch der Lieder, insel-taschenbuch, Frankfurt 1975, Nachwort von E. Galley S.284Aber: Mit dem Verbot der literarischen Bewegung "Junges Deutschland" und dabei auch Heines Schriften 1835 wächst das öffentliche Interesse an Heines Werken, die Verlage finden Mittel und Wege, die Zensur zu umgehen, und das >Buch der Lieder< wird zum größten lyrischen Erfolg des 19. Jahrhunderts. Allein bis zu Heines Tod 1856 erscheinen dreizehn Auflagen.
Zum Erfolg tragen auch zahlreiche Vertonungen zeitgenössischer Komponisten bei. Die bedeutendsten Vertonungen sind von Franz Schubert ("Schwanengesang", 1828) und Robert Schumann ("Dichterliebe", 1840).
(cc) Klaus Dautel