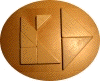Romantik, Vormärz, Realismus ...
K. Dautels Ideen, Materialien und Vorschläge für den Deutschunterricht
Die Materialien stehen unter der Creative Commons Lizenz: CC BY 4.0.
|
CAPUT XIII Die Sonne ging auf bei Paderborn, Sie haben dir übel mitgespielt, |
„Was tut ein Mensch, wenn er gegen den anderen ironisch wird?Fassen Sie Guardinis Gedanken in wenigen Worten zusammen und wenden Sie sie auf Caput XIII an. Worauf zielt Heines Ironie?
Er bringt ihn in ein fragwürdiges Licht. Das könnte er auch ohne Ironie tun. Er könnte auch direkt etwas sagen, was den Angegriffenen sonderbar oder komisch erscheinen ließe. Doch würde das verraten, daß er plump ist und ihm nichts Gutes einfällt; die Ironie hingegen ist geistreich. Im direkten Angriff wäre noch ein anderer Nachteil. Wer ihn führte, wäre in die Situation verfangen; der Ironiker hingegen steht in ihr und zugleich über ihr. Sein Angriff zeigt ihn frei und überlegen. So sagt er Anerkennendes, aber in einer Weise, daß dabei Ungünstiges zum Vorschein kommt; er stimmt zu und unterstreicht dadurch den Widerspruch nur umso stärker; er tut harmlos und verwundet umso sicherer.” (Hamburg 1959 S.16/17)
 1) ...
1) ...
2a) Die ersten drei Strophen von Caput XIII setzen als Thema die Vergeblichkeit jeglichen Bemühens, zur Aufhellung bzw. zur Aufklärung der Welt beitragen zu wollen. Die Sonne, Sinnbild der Aufklärung, versucht es jeden Tag aufs neue, aber es ist ein „verdrießlich Geschäft” (Strophe 1). Der Dichter nimmt also eine skeptische Grundhaltung ein, sie wird veranschaulicht durch den Hinweis auf die klassischen Höllenstrafen der antiken Unterwelt: sowohl Sisyphus als auch die Danaiden waren verdammt dazu, immer wieder das Unmögliche zu versuchen.
Von dieser düsteren Grundstimmung her fällt ein nicht weniger düsteres Licht auf die Gestalt des Gekreuzigten: Auch er wollte das Licht und das Heil bringen, hatte sich die Aufklärung und Erlösung der Menschen zum Ziel gesetzt und war nicht müde darin geworden. Auch er hat die unendliche Mühe auf sich genommen, das unmöglich Erscheinende zu versuchen, das ehrt ihn und darin ist zugleich sein Scheitern begründet.
b) So ist auch der Dichter voller „Wehmut” (Str. 5) beim Anblick des Gekreuzigten, mit der Anrede „mein armer Vetter” (a.a.O.) stellt er aber auch eine verwandtschaftliche Beziehung zu diesem her: Er ist ein Vetter im Geiste, und mehr noch: ein Mitstreiter aus der Zunft der Schriftsteller, denn dies ist ja das oberste Anliegen des Dichters: aufzuklären und zu erhellen. Jesus erscheint zuallererst als ein Bundesgenosse des Dichters, genauer gesagt, er hätte es sein können, wäre damals schon die „Buchdruckerei ... erfunden”(Str.7) gewesen.
So aber ist jener Jesus kein Schriftsteller geworden, sondern ein Prediger, mit dessen Anliegen der Dichter sich zu identifizieren scheint. Es ist zum einen die Kritik an Kirche und Staat (Strophe. 6), und zum anderen die Kritik an dem vorherrschen Händler- und Krämergeist (Strophe 10).
Der Dichter und der Gekreuzigte hätten sich in ihrem Kampf gegen die Obrigkeiten und den Mammon solidarisieren können, darin sind sie sich ähnlich und beide sind zugleich Opfer derselben.
Aber da kehrt auch das Motiv der Vergeblichkeit wieder: Der „Menschheitsretter”(Str. 4), dem „Geist und Talent genug”(Str. 9) bescheinigt wird, wird zugleich als „Narr” (Strophe 4) angesprochen, der sich nicht klug zurückzuhalten wusste, der nicht berechnend genug war, sich zu verstellen oder mit den Obrigkeiten zu arrangieren. Er war kein Realist und schon gar kein diplomatischer Politiker. Dafür musste er büßen.
Der Dichter scheint sich deshalb über ihn lustig zu machen, es ist, als schüttle er unterm Kreuz den Kopf über die Naivität des „unglücklichen Schwärmers”. Jedoch, der Dichter ist ja selbst einer, der mit den Obrigkeiten seine Schwierigkeiten hat. Aber im Unterschied zu seinem “armen Vetter” hat er zwei Vorteile im Kampf gegen die Herrschenden und den Ungeist seiner Zeit: Es gibt die Zensur, und er verfügt über die Gabe des Ironikers.
3. Nach Romano Guardini ist Ironie die Kunst des indirekten Angriffes, durch welche der Angreifer seine intellektuelle Überlegenheit ausspielt und sich gleichzeitig unangreifbar macht.
Der Ironiker Heine treibt dieses Angriffspiel in Caput XIII mit der Zensur. Er sagt darüber Lobenswertes und gibt zu erkennen, dass durch sie Größeres, nämlich Aufklärung und Freiheit verhindert wird. Er dankt den Zensoren dafür, dass sie ihn, den Dichter, vor sich selbst schützen, damit er kein Märtyrer seines Schwarmgeistes werde, und doch gibt er zu erkennen, dass die Zensur das Instrument ist, mit welchem die heutigen “Herren vom hohen Rat”(Str.6) doch bloß ihre überkommene Macht und ihr veraltetes Gedankengut schützen.
Abschließend ist festzuhalten: Der Dichter in Heines „Wintermärchen”, welcher in keinem Abschnitt seiner Reise die Gelegenheit ausgelassen hat, sich mit dem herrschenden Zeitgeist und den überkommenen Herrschaftsverhältnissen kritisch auseinanderzusetzen und Preußentum und Spießergeist in ein fragwürdiges Licht zu rücken, tut dies auch in Caput XIII, und bedient sich hierfür als Instrument der Gestalt des Gekreuzigten. Nicht jedoch dieser ist der Angriffspunkt seiner ironischen Kritik, vielmehr verbündet er sich mit dem gescheiterten Menschheitsretter in dessen grundsätzlichem Anliegen, der Aufklärung und Befreiung aus politische und geistiger Knechtschaft. Der Gegenstand der Kritik ist also jene Institution, welche der Aufklärung entgegensteht und am Status Quo mit Gewalt und Tücke festhält: Die Zensur und ihre „Hohen Priester”.
(cc) Klaus Dautel