Ob Kräuter, Ochsengalle oder sogar Gips: Um den Geschmack
schlecht gewordenen Bieres zu übertünchen, versetzten
Brauer ihr Bier noch im Spätmittelalter mit den verschiedensten
Stoffen. Berauschende Mittel wie Bilsenkraut verstärkten
die Wirkung des Alkohols auf den Körper, und Erbsen und
Bohnen ersetzten oftmals das teurere Getreide. Am 23. April 1516
wurde dies schließlich gesetzlich verboten: An diesem Tag
wurde im Rahmen einer bayerischen Landesordnung das Reinheitsgebot
für Bier erlassen, demzufolge Bier lediglich Wasser, Hopfen
sowie zu Malz veredelte Gerste enthalten dürfe. Später
wurde diese Regelung auf ganz Deutschland ausgeweitet, sie ist
damit das älteste noch heute gültige Lebensmittelgesetz.
Zum 500-jährigen Jubiläum zeigt das TECHNOSEUM in Mannheim
deshalb vom 19. Februar bis zum 24. Juli 2016 die Sonderausstellung „Bier.
Braukunst und 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot“.

Befüllung der Fässer bei der Hoepfner Brauerei,
1900. Bild: Hoepfner-Brauerei, Karlsruhe
"Die 189 Brauereien in Baden-Württemberg – von
Kleinstbrauereien bis zu großen Mittelständlern – brauen
handwerklich extrem gutes Bier“, so Hans-Walter Janitz,
Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Brauerbundes. „Neben
dem Prinzip Klasse statt Masse sind es die meisten Biersorten
aller Bundesländer, die Baden-Württembergs Brauwirtschaft
so stark machen. Diese regionale Biervielfalt liegt uns am Herzen,
weshalb wir die Ausstellung in Mannheim gerne fördern.“
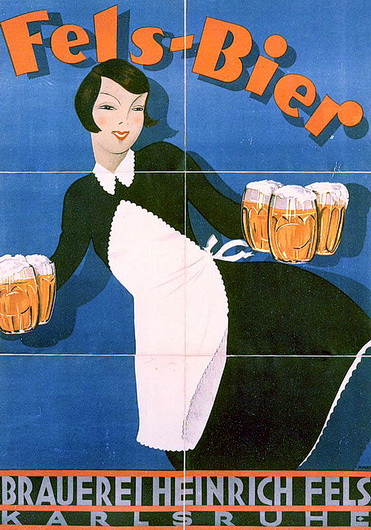 Neben
Regional- und Lokalgeschichte zeigt die Schau im TECHNOSEUM auch,
wie sich Technik-, Sozial- und Kulturgeschichte beim Thema Bier
miteinander verschränken: „Schließlich waren
es bayerische Brauer, die dem Tüftler Carl Linde den Auftrag
gaben, eine Kältemaschine zu konstruieren, mit der sich
gärendes Bier kühlen ließ: der Vorläufer
unserer heutigen Kühlschränke“, unterstreicht
Projektleiterin Dr. Anne Mahn. Technische Innovationen wie der
Kronkorken, der 1892 patentiert wurde, oder die Entwicklung der
Dose hatten auch gesellschaftliche Auswirkungen, da sich durch
sie die Trinkkultur von der Kneipe ins heimische Wohnzimmer verlagerte. Neben
Regional- und Lokalgeschichte zeigt die Schau im TECHNOSEUM auch,
wie sich Technik-, Sozial- und Kulturgeschichte beim Thema Bier
miteinander verschränken: „Schließlich waren
es bayerische Brauer, die dem Tüftler Carl Linde den Auftrag
gaben, eine Kältemaschine zu konstruieren, mit der sich
gärendes Bier kühlen ließ: der Vorläufer
unserer heutigen Kühlschränke“, unterstreicht
Projektleiterin Dr. Anne Mahn. Technische Innovationen wie der
Kronkorken, der 1892 patentiert wurde, oder die Entwicklung der
Dose hatten auch gesellschaftliche Auswirkungen, da sich durch
sie die Trinkkultur von der Kneipe ins heimische Wohnzimmer verlagerte.
Werbeplakat der Brauerei Heinrich Fels aus Karlsruhe, 1920.
© Technoseum Mannheim
Nicht zuletzt war Bierbrauen in früheren Zeiten vor allem
Frauensache und ein Sudkessel oftmals fester Bestandteil der
Mitgift – erst mit der Technisierung änderte sich
dies. Neben Rausch, Sucht und Prävention beschäftigt
sich die Ausstellung außerdem mit der Vermarktung des Bieres,
bei der Lokalpatriotismus und Heimatgefühl im Mittelpunkt
stehen – weshalb nicht zuletzt das Bier auch als Imagefaktor
für das Selbstbild der Deutschen eine große Rolle
spielt. „Bier ist ein Getränk, das jeder kennt. Gleichzeitig
ist es heute oftmals das Produkt eines hoch technisierten Herstellungsprozesses“,
so TECHNOSEUM-Direktor Prof. Dr. Hartwig Lüdtke. „Es
ist damit als Thema wie geschaffen für eine vielseitige
Ausstellung in einem Museum, das sich sowohl der Industrialisierung
als auch der Alltagskultur widmet.“ Hier ist Bier nie aus
Die Ausstellung lädt mit über 300 Exponaten auf 800
Quadratmetern zu einer Zeitreise durch 4.000 Jahre Bierbrauen – angefangen
beim Brotbrei der Sumerer über den Beginn der industriellen
Herstellung im späten 19. Jahrhundert bis hin zum Craft-Beer-Trend
in heutiger Zeit. „Die Besucherinnen und Besucher können
sich über die historische Entwicklung ebenso informieren
wie über Rohstoffe, die Bierherstellung und den Weg zum
Konsumenten – deshalb lag es nahe, die Bierkiste als gestaltendes
Element einzusetzen, ein Objekt, das sowohl der heute hochkomplexen
Distribution eines Massenproduktes dient als auch beim Endkonsumenten
bekannt ist“, erläutert Stefan Nowak von der Agentur
nowakteufelknyrim, die die Ausstellungsarchitektur beisteuerte.
Große Objekte wie eine Sudhaube, ein Stammwürzekühler,
ein Verschneidbock, eine Abfüllanlage und eine Bierkutsche
machen den Brauprozess und die Verteilung des Bieres nachvollziehbar.
Diverse Brauereien wie Eichbaum in Mannheim, die Woinemer Hausbrauerei
oder Rothaus aus dem Hochschwarzwald haben hierfür Leihgaben
zur Verfügung gestellt.
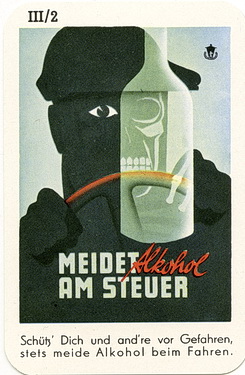 Die Besucherinnen und Besucher können
auf Tablets virtuelles Bier brauen, Bierdeckel bedrucken oder
an einer Hörstation Trinksprüchen aus aller Welt lauschen.
TECHNOscouts zeigen die einzelnen Schritte im Brauprozess, indem
sie eine Jodprobe auf Stärkereste durchführen und den
Alkoholgehalt messen. Zwischendurch kann man an der Craft-Beer-Theke
verweilen und einen Schluck Bier probieren – allerdings
nur nach 14.00 Uhr und wenn man mindestens 16 Jahre alt ist:
Denn auch der Umgang mit Alkohol sowie seine Kehrseiten sind
wichtige Themen der Schau. So zeigen verschiedene Stationen,
welche Auswirkungen Alkohol auf den Körper hat und wie sich
die eigene Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss verändert. Die Besucherinnen und Besucher können
auf Tablets virtuelles Bier brauen, Bierdeckel bedrucken oder
an einer Hörstation Trinksprüchen aus aller Welt lauschen.
TECHNOscouts zeigen die einzelnen Schritte im Brauprozess, indem
sie eine Jodprobe auf Stärkereste durchführen und den
Alkoholgehalt messen. Zwischendurch kann man an der Craft-Beer-Theke
verweilen und einen Schluck Bier probieren – allerdings
nur nach 14.00 Uhr und wenn man mindestens 16 Jahre alt ist:
Denn auch der Umgang mit Alkohol sowie seine Kehrseiten sind
wichtige Themen der Schau. So zeigen verschiedene Stationen,
welche Auswirkungen Alkohol auf den Körper hat und wie sich
die eigene Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss verändert.
„Meidet Alkohol am Steuer”: Ein Quartettspiel
aus den 1970er Jahren. © Technoseum Mannheim Keine Durststrecke im Rahmenprogramm
Darüber hinaus bietet das Museum mit Vorträgen, Braukursen
Bierverkostungen, Workshops und Führungen zahlreiche Blicke über
den Braukesselrand: So referieren Experten im TECHNOSEUM unter
anderem über die Kulturgeschichte des Bieres, über
die Brau- und Getränketechnologie oder den Boom von Trachten
und Traditionen im Zeichen des Oktoberfestes.
Am Tag des Deutschen
Bieres, dem 23. April, können die Besucherinnen und Besucher
Bierkreationen von regionalen Braumeistern verkosten oder bei
einem Sensorikseminar die Sinne schärfen. Immer freitags
sowie an Sonn- und Feiertagen lädt das Museum um 14.00 Uhr
zur öffentlichen Führung durch die Ausstellung, die
im regulären Eintrittspreis inbegriffen ist. Außerdem
werden After-Work-Führungen angeboten, bei denen auch ein
Feierabendbierchen in der Arbeiterkneipe des Museums nicht fehlt – oder
man nimmt an einer Führung am 17. März teil, dem St.
Patrick’s Day: Dann nämlich steht der aktuelle Craft-Beer-Trend
im Mittelpunkt der Führung. Und wer noch mehr Interesse
an Hopfen und Malz hat, kann die Katalogbroschüre erstehen
(ISBN-Nr. 978-3-9808571-8-5, 10,00 Euro im Museumsshop): Auf
164 Seiten kann man die Geschichte des Bierbrauens noch einmal
in Ruhe zu Hause nachlesen – am besten bei einem kühlen
Pils, wahlweise auch alkoholfrei. |