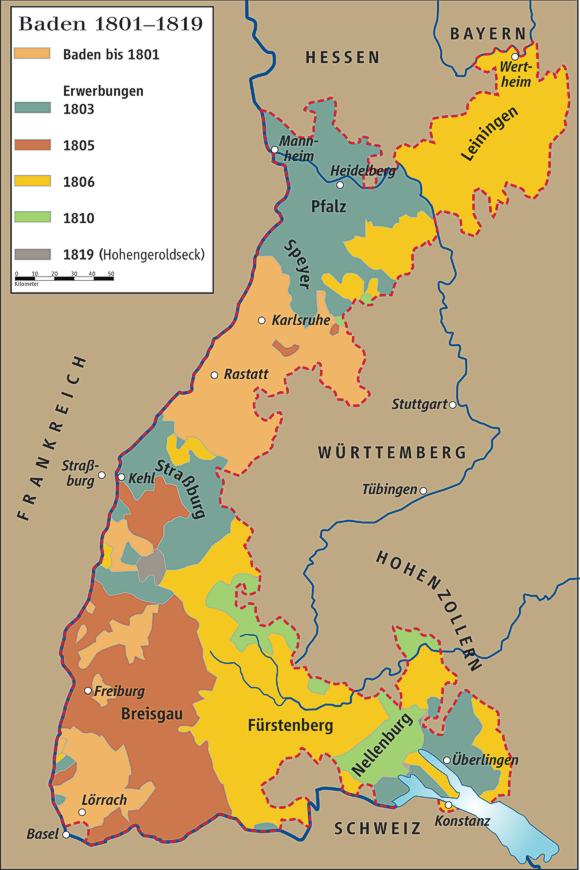
Erwerbungen Badens 1802 - 1819. Karte: Wikimedia Commons/ziegelbrenner
CCA-SA 3.0
Auf Wunsch Napoleons wurde Baden mit dem Ende des
Alten Reiches auf ein Vielfaches seines alten Besitzes vergrößert.
Ziel war für den Franzosenkaiser, einen Mittelstaat zu schaffen,
der als Vorfeld gegen die weiteren süddeutschen Staaten dienen konnte.
Durch die Vergrößerung auf eine strategisch eigentlich unsinnige
Form konnte Napoleon die politische Abhängigkeit steigern; sie wurde
dann durch eine Bindung an das Kaiserhaus - die
Ehe des Erbprinzen Karl mit Napoleons Adoptivtochter Stéphanie Beauharnais
- auch verwandtschaftlich untermauert.
Warum ausgerechnet das kleine
Baden zum MIttelstaat aufgebaut wurde, hatte mehrere Gründe.
Zum einen stand mit dem greisen Markgrafen Karl Friedrich ein Fürst
zur Verfügung, der einerseits Tradition verkörperte, andererseits
über diese erhebliche Aufwertung (er wurde zunächst Kurfürst, dann
Großherzog) aber dem französischen Einfluss offen stand. Die anderen
beiden Mächte wären Bayern gewesen, das mit einer Vergrößerung
der Kurpfalz zu groß geworden wäre, und Österreich, das durch Napoleons
Politik gerade aus dem Reich hinausgedrängt werden sollte.
Bis 1801 bestand Baden aus den (1771 vereinigten)
alten Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach mit dem zu
Baden-Durlach gehördenden Gebieten der Oberen Markgrafschaft um Emmendingen
und im Markgräflerland. Der Reichsdeputationshauptschluss 1803 gab
die rechtsrheinische Kurpfalz sowie die rechtsrheinischen Territorien
der Hochstifte Speyer, Straßburg, Basel und Konstanz an Baden.
1805 kamen Vorderösterreich (samt dem von ihm abhängigen Gebiet der
ortenauischen Reichsritterschaft) dazu, mit der Gründung des Rheinbunds
1806 die Gebiete der Fürstentümer Fürstenberg und Leiningen. Territoriale
Ausgleichsverträge brachten 1810 das Gebiet der Landgrafschaft Nellenburg
und 1819 die ehemalige Grafschaft Hohengeroldseck an Baden.
 Großformatige
Karte zur Zuordnung einzelner Orte Großformatige
Karte zur Zuordnung einzelner Orte |

Glasfenster aus Schloss Baden-Baden mit dem seit 1807 festgelegten
großherzoglichen Staatswappen). Die beiden Wappentiere Badens
halten einen Schild mit den Wappen der altbadischen und der zwischen
1802 und 1806 erworbenen: die Kurpfalz, die Ortenau, Teile der
Hochstifte Speyer (mit Bruchsal), Straßburg (mit Ettenheim) und
Konstanz, das Großpriorat Heitersheim, Teile der Grafschaft Eberstein,
das Stift Odenheim, die Reichsstadt Gengenbach, die Grafschaft
Bonndorf, Salem, Petershausen, die Reichenau, Ohningen, die Reichsstädte Überlingen
und Pfullendorf, die Grafschaft Hauenstein, Rheinfelden, Mainau,
Blumenfeld, die Kommenden Beuggen und Freiburg, Konstanz, Villingen
und Bräunungen. Unter dem Schild sind die Wappen jener Standesherrschaften
dargestellt, die der Souveränität des Großherzogs unterstellt
sind.
Baden-Baden, 1806
Bemaltes Glas, 185 x 84 cm (mit. Rahmen)
Privatbesitz |