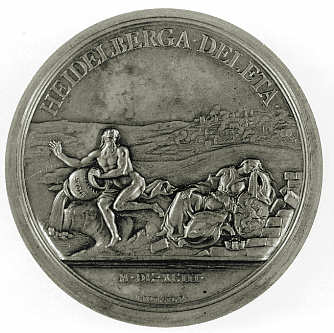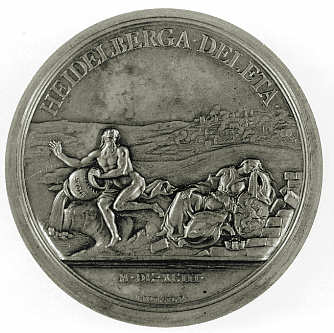 |
"Der menschliche Witz ist von den ältesten Zeiten her
auf allerley Mittel bedacht gewesen, das Andencken berühmter Personen
und merckwürdiger Begebenheiten zu verewigen und unsterblich zu
machen. Von allen in diese Absicht angewandten Bemühungen ist
ihm wohl keine besser gelungen, als da er auf den Einfall gerathen,
dasjenige, was er der Vergessenheit entreißen wollte, auf Gold,
Silber und Ertz zu prägen und der Nachwelt in Müntzen vorzulegen",
schrieb anno 1759 der Zweibrückener Gymnasiallehrer Friedrich
Ludwig Exter (1714 - 1787) in seinem dem Kurfürsten Karl Theodor
gewidmeten "Versuch einer Sammlung von pfältzischen Medaillen"
im Vorwort.
Der Sonnenkönig Ludwig XIV. war einer der ersten Regenten der
Neuzeit, der sich der Wirkung der Medaille als Propagandamittel
zur Verfolgung staatspolitischer Ziele bewusst war. Er beschäftigte
einen großen Stab an Wissenschaftlern und Künstlern in seiner
Akademie, um entsprechende Emblemata zusammenzustellen, die als
Rückseitenbilder für seine "Histoire métallique" Verwendung und
wie Flugblätter und Flugschriften reißenden Absatz weit über die
Grenzen des eigenen Landes hinaus fanden. Dominieren im 16. Jahrhundert
in erster Linie die Wappen der Herrscherhäuser die Rückseiten
der Medaillen, so fließen im 17. Jahrhundert verstärkt historische
Ereignisse oder die Darstellung politischer Ziele und Haltungen,
kunstvoll ausgedrückt durch eine barocke Allegorie, in die Gestaltung
von Medaillenrückseiten ein.
Auch Liselotte von der Pfalz hatte
eine leidenschaftliche Vorliebe für solche Medaillen. Aus ihrer
umfangreichen Korrespondenz mit den Verwandten an den europäischen
Höfen wissen wir, dass die Herzogin von ihrem Vater Karl Ludwig
das lebendige Interesse für Numismatik geerbt hat. Zwar galt ihre
besondere Liebe antiken Münzen, daneben aber auch europäischen
und orientalisch geprägten, ebenso Medaillen und selbstverständlich
pfälzischen Stücken, die sie sogleich in ihr Münzkabinett einordnete,
wenn sie ihrer habhaft werden konnte.
Die obige Medaille wird
dabei ihrer besonderen Aufmerksamkeit nicht entgangen sein. Sie
lenkt des Blick des Betrachters auf die Ereignisse des Jahres
1693, "da die Zorn-Schale Gottes völlig über Heydelberg sollte
ausgegossen, und sie wegen ihren Sünden mit einer scharffen Zucht-Ruthe
heimgesucht wurden,."(Johann Peter Kayser, 1733) - gemeint ist
das denkwürdige Ereignis der zweiten Zerstörung Heidelbergs am
22. Mai 1693 im so genannten Pfälzischen Erbfolgekrieg.
An diesem
Tag vollendeten die Truppen des französischen Sonnenkönigs unter
ihrem Brigadier Mélac das Zerstörungswerk, das sie vier Jahre
zuvor, im Januar 1689, begonnen hatten. Nachdem ihnen die Stadt
kampflos in die Hände gefallen war, pferchte man die Bevölkerung
in der Heiliggeistkirche zusammen und setzte die Kirche in Brand.
Auf dem Schloss sprengte man den Pulverturm, der zusammen mit
den übrigen Gebäuden des Areals und den Häusern der Stadt in hellen
Flammen aufging. Die Stadt und ihre Bewohner wurden Opfer des
Großen Brandes, der viele Häuser bis auf die Keller zerstörte.
Auf der Suche nach Beutegut und verwertbarem Metall öffnete man
sogar die kurfürstlichen Gräber und warf die Gebeine der Bestatteten
auf die Straße.
Ludwig XIV., dem man in diesem Fall Rachegefühle
nicht absprechen kann, feierte die Meldung von der völligen Zerstörung
Heidelbergs mit einem Festgottesdienst und ließ aus Genugtuung
darüber eine Gedenkmünze anfertigen.
Die Vorbereitung hierfür
hatte die Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres zu
leisten. Die klassisch kurze Formulierung der Devise gemahnt in
ihrer Unerbittlichkeit und Endgültigkeit an die von dem älteren
Cato während des dritten punischen Krieges zur geflügelten Redewendung
gewordene Äußerung: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"
(Im übrigen beantrage ich, Karthago müsse zerstört werden"), die
wie im Fall Heidelberg auch das Wiederansiedlungsverbot der vertriebenen
Einwohner beinhaltete. Nach der Intention des Dichters Boileau
(1636 - 1711) hat der Maler und Kupferstecher Sebastian Le Clerc
(1637-1714) den Entwurf gestaltet, für den dann im Laufe des Jahres
1694 der Hofmedailleur Jérome Roussel (1663 - 1713), der an der
Histoire métallique du règne de Louis XIV. beteiligt war, die
Wachsmodelle und Stempel für die Medaille lieferte.
Wir erkennen
auf der Vorderseite den Kopf Ludwigs XIV. mit Allongeperücke und
Lorbeerkranz im Profil nach rechts und der Umschrift LUDOVICUS
MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS. Am Halsabschnitt H.(ierome) ROUSSEL.F(ecit).
Die Rückseite zeigt im Vordergrund links den bärtigen Flussgott
Neckar, eine Wasserurne ausleerend, rechts die trauernde, nach
antikem Vorbild gewandete Stadtgöttin Heidelberga. Sie sitzt weinend
auf dem zerbrochenen ovalen Wappenschild mit dem Heidelberger
Löwen und stützt sich auf die Trümmer der Zerstörung. Der Hintergrund
öffnet den Blick auf eine Landschaft mit dem brennenden Heidelberg,
die Umschrift HEIDELBERGA - DELETA verkündet "Heidelberg ist zerstört".
Im Kreissegment findet sich die Jahreszahl M-DC-XCIII, darunter
H. ROUSSEL F(ecit).
Das Exemplar des Kurpfälzischen Museums wurde
1867 auf Ansuchen des Heidelberger Rechtsanwalts Albert Mays in
der Pariser Münze aus dem Originalstempel nachgeprägt und der
Städtischen Altertümersammlung des Grafen Charles de Graimberg
überlassen. Inwiefern die brutalen Verwüstungen großer Teile des
Rheinlandes im Pfälzischen Erbfolgekrieg ihr militärisches Ziel
erreichten und dazu beitrugen, dass der französische Festungsgürtel
gegenüber den im Türkenkrieg erfolgreichen Truppen des Kaisers
und des Reichs standhalten konnte, da aus den entvölkerten und
zerstörten Landstrichen keine ernstlichen Gegenaktionen zu fürchten
waren, ist bis heute umstritten. Sicher hingegen ist, dass das
Ansehen Frankreichs und seines Königs in der öffentlichen Meinung
Europas eine ungeheure Einbuße erlitt. Die Empörung im Reich über
die französischen Gräueltaten war allgemein und wurde zusätzlich
durch eine entsprechende Publizistik angeheizt. Getroffen und
bis in ihre Träume geplagt war die unglückliche Liselotte von
der Pfalz. Kurfürst Philipp Wilhelm sprach gar vom "occidentalischen
Türken", der solches anrichtete.
Die negative Langzeitwirkung der französischen Zerstörungspolitik
war im Fühlen und Denken nicht nur der Pfälzer noch bis ins 20.
Jahrhundert hinein spürbar und die geschichtlichen Ereignisse
aus jener Zeit blieben weit über den pfälzischen Raum hinaus ein
populärer, emotionsbefrachteter Gesprächsstoff.
Text: Frieder Hepp
|