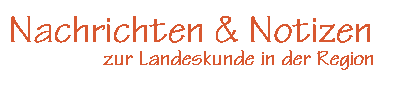
6/02
MenschenZeit
Geschichten vom Aufbruch der frühen Menschen
17. Dezember 2002 bis 18. Mai 2003
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim
Konzept und Aufbau
Das Jungpaläolithikum in Europa begann vor ca. 38.000 und endete vor ca.11.500 Jahren, es umfasste mehrere Kulturen mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen, unter anderem das Aurignacien, das Gravettien und das Magdalénien. Die Entwicklung im Jungpaläolithikum scheint eng mit dem modernen Menschen verbunden zu sein, zu ihr gehörten die weltweit erstmaligen künstlerischen Äußerungen.
Als bewegliche Kunst werden alle Figuren und verzierten Objekte bezeichnet, die man transportieren kann. Die einfachsten Formen dieser Kunst finden sich als Verzierung auf Jagdwaffen, Harpunen und Lochstäben; auf Knochen und Steinen können geometrische Muster oder Figuren eingeritzt sein. Es gibt weiterhin viele Figuren aus Stein, Knochen, Elfenbein oder sogar gebranntem Ton, die vor allem Tiere darstellen. Die seltenen Menschenbilder sind oft unvollständig und schemenhaft. Im Unterschied zur beweglichen Kunst ist die Wandkunst ursprünglich nicht transportabel. Man findet sie heute auf großen, abgestürzten Steinblöcken, unter Felsdächern, am Eingang und in den Tiefen der Höhlen. Weil die Farbe sich an der freien Luft nicht erhielt, sind uns aus dem äußeren Bereich nur Gravuren und Halbreliefs bekannt. Warum die Menschen die Bildwerke geschaffen haben, ist unklar. Vielleicht gehörten sie zu einem Jagdzauber, einem Fruchtbarkeitsritus oder einem Mondritual, vielleicht liegen ihre Ursprünge in einem frühen Totemismus oder Schamanismus?
Dass die Menschen des Jungpaläolithikums Musik kannten, ist durch viele Arten von Instrumenten belegt, wie zum Beispiel Flöten, Schwirrhölzer, Schlaginstrumenten aus bemalten Mammutknochen ("Knochenxylophon") oder Lochstäben mit einer Reihe von Einkerbungen, auf denen man mit einem Stab in der Art einer Ratsche hin- und herreiben konnte. Es ist auch wahrscheinlich, dass Tropfsteine als Schlaginstrumente benutzt wurden.
Das Holzfragment des vielleicht "ältesten Bogen der Welt" ist in doppelter Hinsicht eine Besonderheit, wegen des Materials und der Bearbeitungsspuren, die auf die Funktion als Bogen hinweisen, und wegen seiner Zeitstellung. Es stammt aus einer Zeit, aus der wir Steinwerkzeuge kennen, die als Pfeilspitzen gedeutet werden, ohne dass man aber Bögen gefunden hätte. Ein weiterer bedeutender Fund ist der Lehmabdruck eines aus Pflanzenfasern gewebten Stoffes aus Pavlov. Es handelt sich um den bisher ältesten Beweis für Weberei. Daneben gibt es Hinweise auf das Vorhandensein von Seilen, Schäftungen, Speerschäften, Zeltpfosten, Fellen, Fäden aus Pferdehaaren, aus Sehnen oder Bast. Typisch für das Jungpaläolithikum ist die Herstellung von Klingen, die bei einer Breite von 1-2 cm bis zu über 30 cm lang sein konnten.
Im Jungpaläolithikum treten bearbeitete Gegenstände aus Knochen, Geweih und Elfenbein in vorher nicht gekannter Häufigkeit auf. Dies könnte mit der Verschlechterung des Klimas zusammenhängen, die die Bäume weitgehend verschwinden ließ und so die Menschen zwang, andere Materialien zu benutzen. Für die Bearbeitung von Knochen, Geweih und Elfenbein wurde ein besonderes Werkzeug eingesetzt: der Stichel.
Aus dem Jungpaläolithikum sind viele Bestattungen bekannt. Sie sind sehr vielfältig und spiegeln vermutlich eine komplexe Gesellschaftsstruktur wider. Grabbeigaben werden häufiger. Schmuck findet sich in den Gräbern verhältnismäßig oft.
In den Feuerstellen des Jungpaläolithikums sind aus Mangel an Holz oft Knochen verbrannt worden, auch Steinkohle wurde zum ersten Mal genutzt. Zum Brennen von Tonfiguren wurden die ersten Brennöfen gebaut. Viele Erfindungen dieser Zeit dienten der Nahrungsbeschaffung: Die Speerschleuder wirkte wie eine Verlängerung des Armes und verlieh dem Speer eine viel größere Reichweite und Durchschlagskraft. Angelhaken, Knebel und Harpunen belegen zum ersten Mal eine organisierte Fischerei. Der Lochstab wurde benutzt, um die natürlich gekrümmte Knochen-Geschossspitze kurz vor dem Schuss gerade zu biegen. Eine weitere wichtige Erfindung ist die Nähnadel, sie ermöglicht es, das Leder zu durchbohren und gleichzeitig den Faden durch das Loch zu ziehen.
Höhlen und Felsdächer wurden im Jungpaläolithikum weiterhin sehr intensiv als Siedlungsplätze genutzt. Dazu kamen vielgestaltige Freilandsiedlungen. Fleisch konnte über dem Feuer gebraten oder geräuchert werden. Kochsteine wurden im Feuer erhitzt und anschließend ins Wasser geworfen. Sie brachten es so zum Kochen, mit dem heißen Wasser konnten Suppen und Kräutertees zubereitet werden.
Im Jungpaläolithikum verschwanden die Wälder fast ganz. Die Landschaft bestand nun in weiten Teilen aus Grasflächen und Zwergbaum- und Strauchvegetation. Typische Tierarten dieser arktischen Tundra waren Mammut, Wollnashorn, Rentier, Wildpferd, Vielfraß und Schneehase.
Bezirksgruppe Bergstraße - Neckartal (Heidelberg)