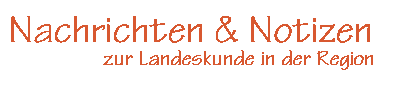
3-4/00
300 Jahre Barockresidenz Rastatt (1700 — 2000)
Ein Juwel der Architekturgeschichte wird gefeiert
Die Einrichtung der Prunkräume der Bel-Etage wird mit kostbaren Möbeln und Gemälden ergänzt, die beim Saisonauftakt der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit Finanzminister Gerhard Stratthaus am 5. Mai 2000 zum ersten Mal gezeigt wurden. Zum Jubiläum erschien ein Sonderheft des Schlösser-Magazins mit Beiträgen zur Geschichte der Residenz und ihrer markanten Bewohner. Am 15. Juli werden die Schlossportale für Groß und Klein offenstehen. Musik- und Tanzeinlagen, interessante Führungen sowie Kinderaktionen sind geplant, um den Tag lebendig zu gestalten. Höhepunkt des „Tages des offenen Schlossportales" ist eine festliche Beleuchtung mit Feuerwerk am Abend.
Ein riesiger Ehrenhof, umschlossen von einer monumentalen Dreiflügelanlage mit einer ausladenden Fassadenfront. die goldleuchtende Gestalt des blitzeschleudernden Jupiters, der mit göttlicher Gebärde die Dachbekrönung des Corps de Logis beherrscht — so empfängt die älteste Barockresidenz am Oberrhein heute noch, wie vor 300 Jahren ihre Gäste. Ein wahrhaft barocker Geist durchdringt die gesamte Schlossanlage. Klare Ordnung und strenge Symmetrie mit der Mittelachse, die sich als Allee im Park fortsetzt und dem dreistrahligen Achsensystem als Verbindung zwischen Schloss, Stadt und Park bestimmen ihre Gestaltung. Rastatt war die erste Residenz auf deutschem Boden, die nach dem großartigen Vorbild von Versailles zur Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert gebaut wurde - und zugleich auch die, die das französische Vorbild am getreusten nachempfand.
Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, der „Türkenlouis". ließ das schon 1698 begonnene Jagdschloss ab 1700 zur mächtigen Residenz ausbauen.
Die Weite der Rheinebene eröffnete dem siegreichen Helden der Türkenkriege die Möglichkeit, seine Machtansprüche zu verwirklichen. Die neue dreigliedrige Einheit von Schloss, Park und Stadt, als Gesamtkunstwerk geplant, entsprach ganz dem herrschaftlichen Barockideal. Die Anlage sollte jedoch von Befestigungsmauern umgeben sein und die Stadt mit Modellhäusern nach Plan errichtet werden. Der damals am Wiener Hof bekannte italienische Architekt Domenico Egidio Rossi wurde mit der Umsetzung dieses kühnen Vorhabens beauftragt. Der Traum des badischen Reichsfürsten von der Selbstdarstellung seiner sich im Hof und dessen Glanz spiegelnden Herrschaft wurde nur für eine kurze Weile wahr, denn er starb 1707, als sein Schloss mit „Symmetrie und Magnificenza" gerade fertiggestellt war.
Die über die Jahrhunderte in großen Teilen erhalten gebliebene Schlossanlage wurde im 2. Weltkrieg nicht zerstört und stellt ein einzigartiges, authentisches Beispiel einer Residenz des frühen 18. Jahrhunderts dar. Die unveränderte, gesamte Raumfolge in den beiden Staatsappartements der Bel-Etage — Vorzimmer, Audienzzimmer oder Thronsaal und Prunkschlafzimmer — lassen das höfische Zeremoniell eines absolutistischen Herrschers noch heute nachempfinden. Ungewöhnlich gut erhalten sind die Fresken der Künstler aus Bologna in den Appartments der Markgrafen und der Markgräfin. Mythologische Malerei und qualitätvolle Stuckdekoration sind ebenso vertreten wie Quadraturmalerei, eine der damals modernsten und repräsentativsten italienischen Dekorationsformen des 17. Jahrhunderts. Ihre Besonderheit besteht in der Einheit der illusionistischen Darstellung von Architektur. Fresko und Stukkatur, die dem Raum ein Höchstmaß an Glanz verleiht. Der Rastatter Zyklus ist einzigartig durch seine Vollständigkeit, denn in Italien selbst sind derartige Dekorationen nur sehr selten.
Mittelpunkt der gesamten Schlossanlage ist der Ahnensaal, Schauplatz rauschender Feste mit aufwendigen Singspielen und Opern, die für Namens-und Geburtstage der Markgrafenfamilie sowie Festtage von Johann Caspar Ferdinand Fischer komponiert und aufgeführt wurden. Die prachtvolle originale Ausstattung dieses Raums ist beeindruckend. Kolossalpilaster aus rotgrauem Stuckmarmor, auf denen vollplastische Stuckfiguren gefesselter Türken sitzen, gliedern den Raum. Als Apotheose des Herrschers ist im farbenfrohen Deckenfresko die „Aufnahme des Herkules im Olymp" dargestellt. Der thronende Jupiter entsendet Fama, die geflügelte Personifikation des Ruhmes, um den tugendhaften Kämpfer, der mühevolle Taten vollbracht und sogar den Verführungen der Liebesgöttin Venus widerstanden hat, mit Posaunenklang anzukündigen. Von Putten auf einer Wolke getragen, erhebt sich Herkules in den leuchtenden Himmel der Unsterblichkeit und des Ruhmes. Über der ganzen Szene schwebt mit Schwert und Waage Justitia, die Gerechtigkeit. In der allegorischen Sprache des Barock ist die Gestalt des olympischen Helden mit Ludwig Wilhelm gleichzusetzen und steht symbolisch für den starken, heroischen höfischen Fürsten. der als Streiter für das Christentum sein Leben im Dienste des Kaisers eingesetzt hatte. Phantasievolle Ornamentik, reich mit Gold verziert und aus Stuck geformte Kriegstrophäen schmücken den Festsaal. Die repräsentative Portraitreihe fürstlicher Ahnen, die der Ruhmeshalle den Namen gegeben haben, blickt souverän und gelassen auf die Ereignisse der Gegenwart.
Bezirksgruppe Bergstraße - Neckartal (Heidelberg)