|
|
|
|
|
|
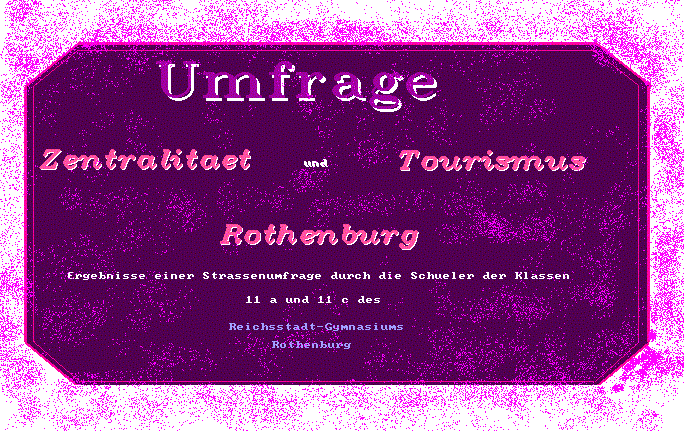
| Schuljahr 1988/1989 | Fragebogen | Vorbereitung | Auswertung | Zusammenfassung im Jahresbericht |
|
| Schuljahr 2000 /2001 |
|
1. Wo leben Sie?
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. Warum sind Sie nach Rothenburg (hierher) gekommen?
|
||||||||||||||||||||||||||||
3. Wie sind Sie nach Rothenburg (hierher) gekommen?
|
||||||||||||||||||||||||||||
4. Wie oft kommen Sie nach Rothenburg?
|
||||||||||||||||||||||||||||
5. Falls 2b) (touristisch) zutrifft
|
||||||||||||||||||||||||||||
6. Falls 2a) (nichttouristisch) zutrifft:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Falls 2a) (nichttouristisch) zutrifft
Wie beurteilen Sie die Parkmöglichkeiten in Rothenburg, wenn Sie maximal 300 Meter zu ihrem Ziel laufen wollen?
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Falls 2a) (nichttouristisch) zutrifft
Wie beurteilen Sie die Anbindung ihres Wohnortes an Rothenburg durch öffentliche Verkehrsmittel?
|
||||||||||||||||||||||||||||
9. Was für Einrichtungen besuchen Sie? (Tourist)
|
||||||||||||||||||||||||||||
10. Was finden Sie in/an Rothenburg gut/schlecht?
|
||||||||||||||||||||||||||||
11. Wieviel Geld werden Sie heute in Rothenburg ca. ausgeben?
|
||||||||||||||||||||||||||||
12.Wofür werden Sie das Geld ausgeben (Mehrfachnennungen
möglich)?
|
||||||||||||||||||||||||||||
1. Projektierung, Durchführung und Auswertung
Im Rahmen des Erdkundeunterrichtes wurde im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres mit den Schülern und Schülerinnen der Klassen 11a und 11c eine Umfrage unter Passanten in Rothenburg zum Thema Zentralität von Rothenburg und die Bedeutung des Tourismus für Rothenburg projektiert und durchgeführt.
Mit der Umfrage sollte einerseits eine Motivation der Schüler für das Unterrichtsthema, andererseits eine Vertrautheit mit erdkundlichen Arbeitsmethoden und - techniken erreicht werden, die durch normalen Unterricht nicht erreicht werden kann.
So erlebten und erarbeiteten die Schüler über einen längeren Zeitraum hinweg die Freuden und Mühen bei der Zielstellung, der Ausarbeitung des Fragebogens, der Erhebung der Daten und deren Auswertung sowie graphische Umsetzung. Insbesondere die graphische Umsetzung ermöglichte den Einsatz eines Computersim Erdkundeunterricht und somit die Möglichkeit auch in dieser Hinsicht die Schüler mit heute in der Geographie üblichen Hilfsmittelnbekannt zu machen.
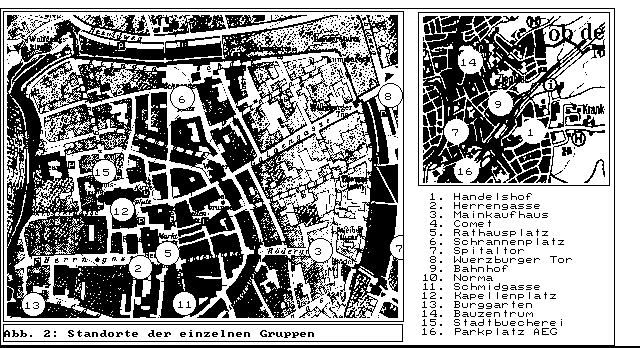 In
zwei Unterrichtsstunden wurde Anfang März der Fragebogen (Abb. 1)
mit den Schülern ausgearbeitet und gestaltet. Am Montag, dem 19. März
wurde dann die Umfrage durchgeführt. In Zweiergruppen befragten die
Schüler Passanten an achtzehn verschiedenen Standorten in Rothenburg
(Abb. 2). Insgesamt wurden 335 Personen befragt, darunter 92 Touristen.
Die Auszählung der Fragebögen erfolgte in zwei weiteren Unterrichtsstunden
vor den Pfingstferien. Nach den Pfingstferien wurden dann die Daten mittels
eines Computers in Diagramme umgesetzt und dokumentiert.
In
zwei Unterrichtsstunden wurde Anfang März der Fragebogen (Abb. 1)
mit den Schülern ausgearbeitet und gestaltet. Am Montag, dem 19. März
wurde dann die Umfrage durchgeführt. In Zweiergruppen befragten die
Schüler Passanten an achtzehn verschiedenen Standorten in Rothenburg
(Abb. 2). Insgesamt wurden 335 Personen befragt, darunter 92 Touristen.
Die Auszählung der Fragebögen erfolgte in zwei weiteren Unterrichtsstunden
vor den Pfingstferien. Nach den Pfingstferien wurden dann die Daten mittels
eines Computers in Diagramme umgesetzt und dokumentiert.
2. Zentralität von Rothenburg
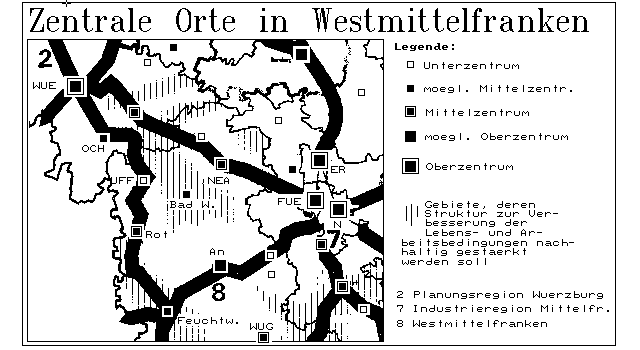 Unter
einem zentralen Ortversteht man nach CHRISTALLER (1933, S.21 - 32) eine
Gemeinde mit einem bestimmten Bedeutungsüberschuß bei der Versorgung
der Bevölkerung mit zentralen Gütern und Dienstleistungen für
die Bewohner des Umlandes. Das bayerische Landesentwicklungsprogramm von
1984 unterscheidet insgesamt sechs verschiedene Arten von zentralen Orten,
die hierarchisch miteinander verknüpft sind: Oberzentren, mögliche
Oberzentren, Mittelzentren, mögliche Mittelzentren, Unterzentren und
Kleinzentren. Für Westmittelfranken und einem Teil der angrenzenden
Planungsregionen sind diese vom Unterzentrum an aufwärts in Abb. 3
dargestellt.
Unter
einem zentralen Ortversteht man nach CHRISTALLER (1933, S.21 - 32) eine
Gemeinde mit einem bestimmten Bedeutungsüberschuß bei der Versorgung
der Bevölkerung mit zentralen Gütern und Dienstleistungen für
die Bewohner des Umlandes. Das bayerische Landesentwicklungsprogramm von
1984 unterscheidet insgesamt sechs verschiedene Arten von zentralen Orten,
die hierarchisch miteinander verknüpft sind: Oberzentren, mögliche
Oberzentren, Mittelzentren, mögliche Mittelzentren, Unterzentren und
Kleinzentren. Für Westmittelfranken und einem Teil der angrenzenden
Planungsregionen sind diese vom Unterzentrum an aufwärts in Abb. 3
dargestellt.
Die Ausweisung von solchen zentralen Orten soll einerseits
mit den daraus resultierenden staatlichen und gemeindlichen Maßnahmen
der Förderung der Wirtschaftsstruktur des zentralen Ortes und seines
Umlandes (Einzugsbereiches) dienen. In sogenannten ländlichen Räumen
, soll z.B. damit eine Verschlechterung der Gesamtstruktur vermieden werden,
die sich z. B. in Abwanderung, Überalterung der Bevölkerung,
geringe Steueraufkommen der Gemeinden etc. auswirkt. Andererseits sollen
zentrale Orte mit ihrer Ausstattung, wie Schulen, Sporthallen, Schwimmbädern
u. a. auch nicht untereinander konkurrieren, da solche Einrichtungen für
die Gemeinden, Kreise und Bezirke mit erheblichen Investitionen und Kosten
verbunden sind. Daher ermittelt man u. a. die sogenannten Pendlereinzugsbereiche
aller zentralen Orte der gleichen Stufe. Bei der Überschneidung der
Einzugsbereiche bzw. "weißen Bereichen" kann das die Förderung
der jeweiligen Gemeinden beträchtlich beeinflussen. Rothenburg selbst
ist nach dem Landesentwicklungsprogramm von 1984 als ein Mittelzentrum
ausgewiesen. 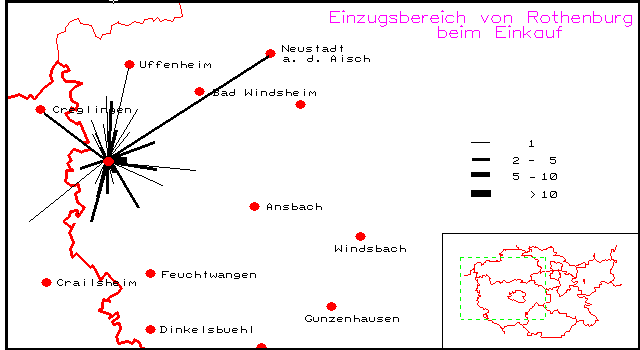 Wie
man aus Abb. 4 erkennt, beträgt die Reichweite des Mittelzentrums
Rothenburg, d. h. die weiteste Distanz, bis zu der das Angebot zentraler
Güter und Dienstleistungen in Rothenburg noch wahrgenommen wird, rund
20 km (ohne Berücksichtigung der Einkäufer aus dem konkurrierenden
Mittelzentrum Neustadt an der Aisch). Längs der im Landesentwicklungsplan
ausgewiesenen Entwicklungsachsen (siehe Abb. 3), also der gut ausgebauten
Bundesstraße 25, ist die Reichweite wesentlich größer
als in westöstlicher Richtung. Ebenfalls aus Abb. 4 erkennbar ist,
daß das sog. Ergänzungsgebiet Rothenburgs nach Baden-Württemberg
hineinreicht. Der Einzugsbereich für Pendler (Schüler und Arbeitskräfte)
deckt sich in etwa mit dem der Einkäufer.
Wie
man aus Abb. 4 erkennt, beträgt die Reichweite des Mittelzentrums
Rothenburg, d. h. die weiteste Distanz, bis zu der das Angebot zentraler
Güter und Dienstleistungen in Rothenburg noch wahrgenommen wird, rund
20 km (ohne Berücksichtigung der Einkäufer aus dem konkurrierenden
Mittelzentrum Neustadt an der Aisch). Längs der im Landesentwicklungsplan
ausgewiesenen Entwicklungsachsen (siehe Abb. 3), also der gut ausgebauten
Bundesstraße 25, ist die Reichweite wesentlich größer
als in westöstlicher Richtung. Ebenfalls aus Abb. 4 erkennbar ist,
daß das sog. Ergänzungsgebiet Rothenburgs nach Baden-Württemberg
hineinreicht. Der Einzugsbereich für Pendler (Schüler und Arbeitskräfte)
deckt sich in etwa mit dem der Einkäufer.
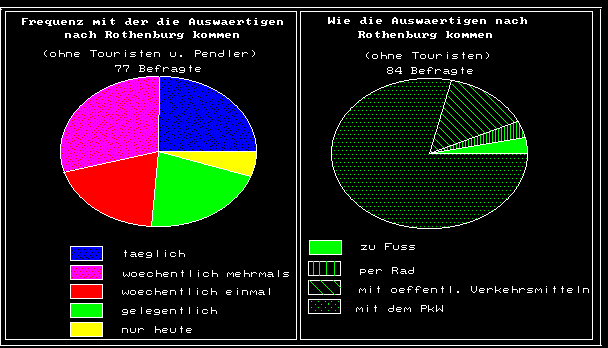 Fast
75 % der Befragten des Ergänzungsgebietes Rothenburgs kommen wöchentlich
mindestens einmal nach Rothenburg (Abb. 5)
Fast
75 % der Befragten des Ergänzungsgebietes Rothenburgs kommen wöchentlich
mindestens einmal nach Rothenburg (Abb. 5)
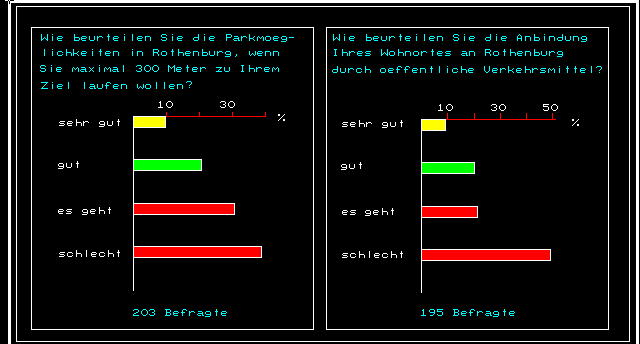 Dabei
benutzen Sie hauptsächlich den eigenen Pkw (Abb.6), da nach ihrerMeinung
die Anbindung ihrer Gemeinde nach Abb. 8 überwiegend nicht zufriedenstellend
ist. Für Einkäufer, die in der Altstadt Besorgungen zu erledigen
haben, erscheint nach Abb. 7 die Parkplatzsituation in Rothenburg als wenig
befriedigend bzw. ein Weg von maximal 300 Metern zu Großparkplätzen
außerhalb der Stadtmauer wird nicht akzeptiert.
Dabei
benutzen Sie hauptsächlich den eigenen Pkw (Abb.6), da nach ihrerMeinung
die Anbindung ihrer Gemeinde nach Abb. 8 überwiegend nicht zufriedenstellend
ist. Für Einkäufer, die in der Altstadt Besorgungen zu erledigen
haben, erscheint nach Abb. 7 die Parkplatzsituation in Rothenburg als wenig
befriedigend bzw. ein Weg von maximal 300 Metern zu Großparkplätzen
außerhalb der Stadtmauer wird nicht akzeptiert.
Der gehobene Bedarf wird nach Abb. 9 überwiegend in den umliegenden (möglichen) Oberzentren Ansbach, Würzburg und Nürnberg gedeckt, wobei bezeichnend ist, daß die Oberzentren Fürth und Erlangen von keinem einzigen der befragten Personen genannt wurde. Einige Spezialgeschäfte, die im Verflechtungsbereich gewünscht sind, befinden sich nicht im Mittelzentrum Rothenburg, sondern in Orten einer geringeren zentralörtlichen Stufe. Offensichtlich nicht zufrieden war ein Großteil der Befragten mit der Versorgung im Bereich von Textilien.
3. Tourismus
Der Tourismus spielt für Rothenburg und dessen nähere Umgebung mit jährlich rund zwei Millionen Touristen eine bedeutende Rolle. Einerseits erzielt die Wirtschaft einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes aus dem Tourismus, andererseits ist aber gerade auch der Tourismus mit erheblichen Problemen verbunden, die sich nicht nur in dem erhöhten Verkehrsaufkommen erschöpfen.
Soll es sich bei dem Tourismus nicht nur um einen Tagestourismus handeln, der nur für spezielle Betriebe eine Bedeutung besitzt, so sind gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen nötig, die u. U. über die Versorgungsfunktion der Gemeinde Rothenburg und dessen Umland hinausgehen. In diesem Zusammenhang erschien es sinnvoll neben der Zentralität auch den Tourismus zu betrachten.
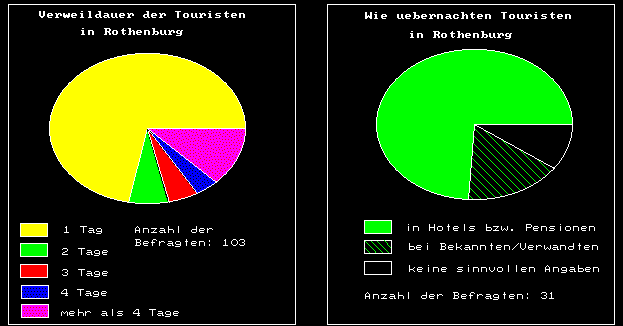 Bei
rund drei Viertel der befragten Touristen handelt es sich um Tagesgäste
(Abb. 10), rund die Hälfte der in Rothenburg übernachtenden Touristen
bleibt mehr als vier Tage.
Bei
rund drei Viertel der befragten Touristen handelt es sich um Tagesgäste
(Abb. 10), rund die Hälfte der in Rothenburg übernachtenden Touristen
bleibt mehr als vier Tage.
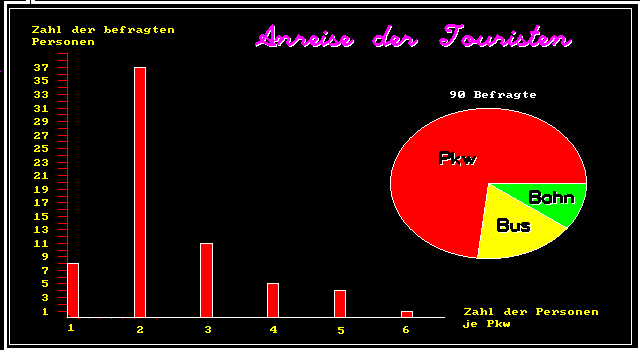 Nach
Abb. 11 handelt es sich beim Großteil der Befragten um Individualtouristen,
von denen wiederum die meisten den Pkw zur Anreise benutzen.
Nach
Abb. 11 handelt es sich beim Großteil der Befragten um Individualtouristen,
von denen wiederum die meisten den Pkw zur Anreise benutzen.
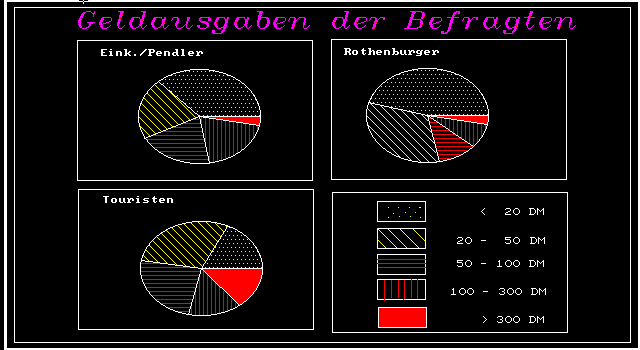 Die
Ausgaben der Touristen liegennach Abb. 12, wie zu erwarten ist, im Durchschnitt
höher als die der Rothenburger bzw. der Auswärtigen aus dem Ergänzungsgebiet
Rothenburgs.
Die
Ausgaben der Touristen liegennach Abb. 12, wie zu erwarten ist, im Durchschnitt
höher als die der Rothenburger bzw. der Auswärtigen aus dem Ergänzungsgebiet
Rothenburgs.
4.Kritik der Umfrage
Die oben getroffenen Aussagen gelten zunächst nur für den betroffenen Untersuchungstag. Bei der zentralörtlichen Betrachtung ist zu erwähnen, daß der Einzugsbereich an einem Freitag oder Samstag vollständig anders aussehen kann. Bezüglich der Analyse der den Tourismus betreffenden Fragen ist zu berücksichtigen, daß eine Untersuchung des Wochenendtourismus bzw. des Tourismus zur Hauptreisezeit bzw. zur Festspielzeit infolge einer ganz anderen Altersstruktur der Touristen und anderer Reisegründe vollkommen andere Ergebnisse nach sich ziehen kann. Ein Vergleich mit weiteren bzw.die Einbeziehung anderer Umfrageauswertungen, wie z. B. der im Frühjahr im Fränkischen Anzeiger erschienen oder der des Komitees 2000 wäre sinnvoll, würde hier aber zu weit gehen.
Klasse 11a, 11c, Heim
Veränderung der Ausgangssituation
Gegenüber dem Schuljahr 1988/1989 haben sich bis heute folgende Veränderungen ergeben:
Als interessante Fragestellungen ergeben sich
Diese Fragestellungen sollen in einer Umfrage im Schuljahr 2000/2001 ansatzweise geklärt werden.
Quellen:
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1984):
Landesentwicklungsprogramm Bayern, München, 324 S.
CHRISTALLER, W. (1933):
Die zentralen Orte in Süddeutschland,eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933 (unveränderter Nachdruck. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
HÖHFELD, V. (1979):
Wandlungen zentralörtlicher Systeme am Beispiel Mittelfrankens in: Strukturanlayse eines Raumes im Erdkundeunterricht, S. 35 - 68, Verlag Auer, Donauwörth
![]() (C)
Bernhard Heim Zuletzt geändert
am 27.8.2000
(C)
Bernhard Heim Zuletzt geändert
am 27.8.2000