|
Wetter contra
Klima
In der vorgelegten
Ausarbeitung wurden die Messergebnisse vornehmlich eines
Wetterelementes, nämlich der Lufttemperatur in verschiedenen
bodennahen Höhen bis 2 m, teilweise der Bodentemperatur oder der
Wassertemperatur, an insgesamt 16 räumlich nahe
beieinanderliegenden Stationen des Taubertales im Ortsteil Tauberzell
der Gemeinde Adelshofen in unterschiedlichen Diagrammen ausgewertet.
Die Absicht dabei
lag darin verschiedene das Mikroklima beeinflussende Faktoren wie
- der Exposition des
Hanges
- dem Gefälle
des Hanges,
- der Beschattung
des Hanges durch das umgebende Relief,
die tages- bzw.
jahreszeitlich abhängig vom Sonnenstand (Elevation und Richtung)
die neben der großräumigen Wetterlage die einfallende
Strahlungsmenge je Flächeneinheit bestimmen,
- dem
Reliefunterschied in der Umgebung des Messstandortes quer und parallel
zum Hanggefälle,
- der Lage am Hang
oder im Tal,
zirkulationsbedingte
lokale Effekte wie Inversionswetterlage oder zirkulationshemmende
Wirkung besitzen zu untersuchen.
Daneben spielen
für das bodennahe lokale Wetter eine Reihe weiterer Faktoren
eine Rolle wie
- die Art der
Bodenbedeckung bzw. die Art des Bodens (Verhältnis von
Einstrahlungsenergie zu Ausstrahlungsenergie) sowie
- die aktuelle
Niederschlagssituation oder die Bodenfechte bzw. die Transpiration der
Pflanzen, die durch die Verdunstungskälte einen kühlenden
Effekt auf zumindest bodennahe Schichten haben sowie
- die
Windgeschwindigkeit und die relative Luftfeuchte, die wiederum die
Verdunstung und damit die Temperatur beeinflussen kann.
Auch diese
Größen sind (jahres)zeitabhängige oder von der
allgemeinen Wetterlage abhängig.
Insgesamt
erweist sich damit das Mikrowetter im Vergleich zum weitmaschig
gelegten amtlichen Netz der Klimastationen, deren Ergebnisse der
Öffentlickeit überwiegend als Mittelwertsdiagramme zur
Verfügung stehen, die dazu noch in vorgegebener 2-m-Höhe
unter künstlich vereinheitlichten Bedingungen gemessen werden als
äußerst differenziertes und auch teilweise kompliziert zu
verstehendes aber reales Phänomen.
Einige wenige
Diagramme aus den vorherigen Punkten sollen dies verdeutlichen. Zur
ausführlichen Darstellung und Interpretation verweisen wir auf die
obigen Ausführungen.
|
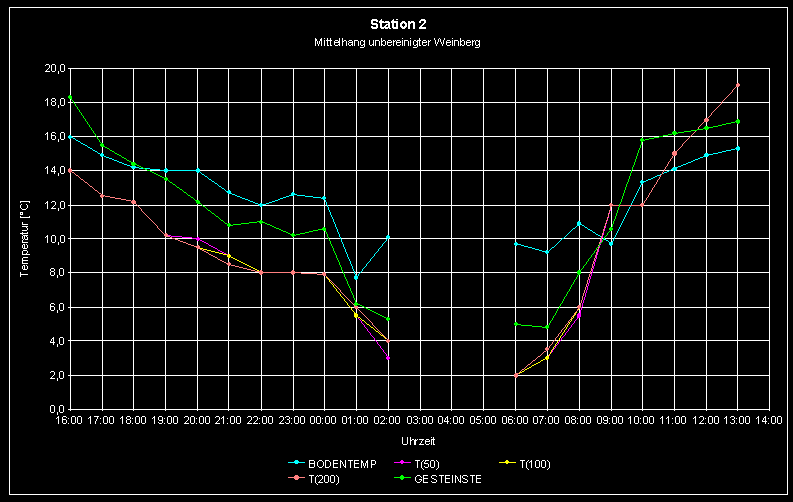
|

© Bayerische
Vermessungsverwaltung 2010
|
|
Beispiel für
den Temperaturgang an einer Station im Laufe eines Tages
|
Lage der Stationen
im Luftbild
|
|
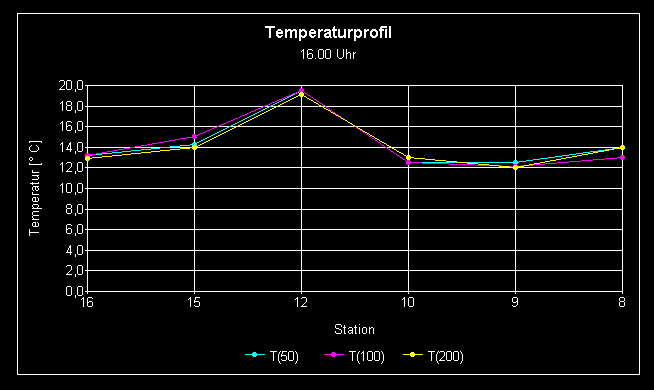
|
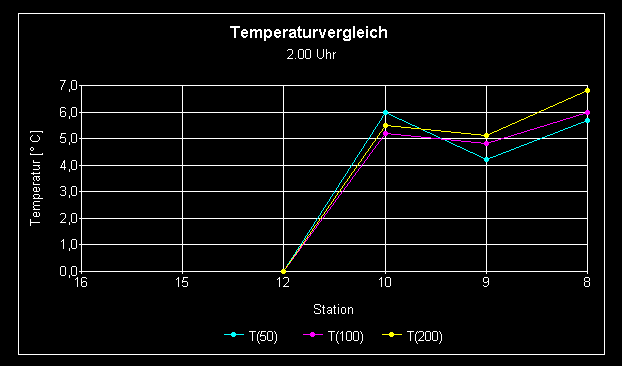
|
|
Thermisches
Normalprofil quer durch das Taubertal bei Tauberzell
|
Temperaturinversion
im Taubertal
|
|
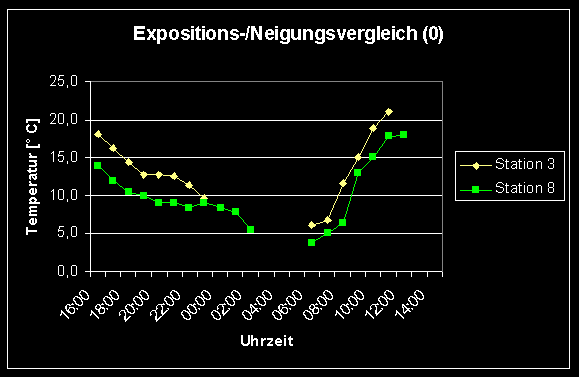
|
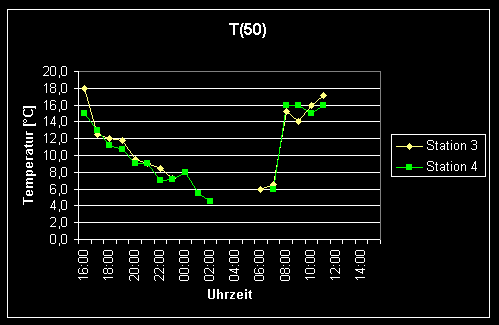
|
|
Beispiel für
einen Expositionsvergleich in Bodennähe ...
|
... und in
50 cm Höhe
|
Der
Zeitpunkt der Erhebung Ende April wurde bewusst gewählt, da er an
den Anfang des Rebaustriebes in Tauberzell fiel. Wie bedeutsam ein
einziger Tag bzw. eine einzige Nacht für Ernte oder Missernte und
damit dass das Mikrowetter - nicht einmal das bereits gemittelte
Mikroklima sein kann mag die an die 0°-Grenze heranreichende
Temperaturinversion an den beiden Messtagen sein. Übertroffen
wurde diese noch durch die Nächte am ...
Denkt man weiter
und an die Prognosen, die infolge eines globalen Klimawandels regional
unterschiedliche Aussagen (für Nord- und Südbayern in
Richtung extremerer Klima- und Wetterverhältnisse)
prognostizieren, so mag das mikroklimatische Wettergeschehen noch viel
größere Kapriolen schlagen - in welche Richtung bleibt hier
aufgrund der komplexen, teils im naturwissenschaftlichen Sinn
chaotischen Verhältnisse aus deterministischem Unverständnis
heraus offen.
Wetter,
Messungen und Schüler
Die
Geländeerhebungen wurden mit den Schülern der Klasse 11 b und
11 c des Reichsstadt-Gymnasiums im Rahmen einer zweitägigen
Geländeexkursion mit einfachen Messgeräten erhoben. Grobe
Fehlmessungen, bedingt durch Ablesegenauigkeit oder geringfügige
Standortabweichungen der wechselnden Schülergruppen an den
einzelnen Messpunkten wurden - wo erkennbar bei den einzelnen
Stationen gekennzeichnet. Dass Erdkunde dann Spass machen kann, wenn
man das "d" streicht und zu "Erkunde!" kommt, gepaart mit einem
stressfreien Erlebnistag, erfuhr der Verfasser bei nächtlichen
Lagerfeuergesprächen und auch aus den Augen mancher, die ansonsten
im herkömmlichen Unterricht mit Erdkunde wenig anzufangen
wissen.
Der Umgang mit
Computerprogrammen zur Auswertung von Daten an sich war vor 20 Jahren
etwas Neues.
Die Tatsache -
selbst erhobene Daten zunächst in ein Datenbankprogramm und dann
in Diagramme umzusetzen - bevor diese selbst in Gruppenarbeit
interpretiert werden verbindet Kenntnisse über arbeitstechnische
Fertigkeiten mit modernen Medien und konventieonellen
"Frage-Antwort-Unterricht" in lehrerzentrierter Form. Die
Vorgehensweise veranlasste einige Schüler nach 2 Stunden
Arbeit im Computerraum zu der ungläubigen und fordernden Aussage
"Wollen Sie das etwa alles selbst machen?", die eigentlich sagen
sollte: "Wir wollen das nun aber wirklich auch selbst machen!" .
Vielleicht und hoffentlich (!) ist dies im Vergleich mit sogenannten
Freiarbeitunterrichtestechniken die Aufgabe der im G-8 anvisierten
Intensivierungsstunden in der Oberstufe. Der Autor ist auf jeden Fall
skeptisch!
Aus
Zeitgründen konnten nicht alle Diagramme im Unterricht in
Gruppenarbeit erstellt werden. Allerdings wurden die Ergebnisse im
Unterricht interpretiert oder zumindest vorgestellt.
Im Einzelnen
für den "konventionellen Unterricht" bedeutsam sind, teilweise zur
Übertragung auf großräumig wirkende Klimafaktoren
geeignet:
- die
Normalschichtung der unteren bodennahen Schicht (->
Temperaturschichtung der Troposphäre)
- die
Inversionswetterlage ( -> Beckenlagen, -> Nutzungsrisiko, ->
Smogbildung)
- Tag- und
Nachtzirkulation in einem Tal,
- der Einfluss der
Exposition und der Bodenbedeckung auf das Mikroklima
- der Einfluss von
Gewässern (-> Modell für maritime, kontinentale Effekte im
Großraum)
|

|
|
|
Die
Temperaturinversion mit Inversionsgrenze an der Nebelschicht morgens um
7 Uhr
|
|
|

|

|
|
Das Verhalten des
Rauches an der Inversionsgrenze, in Hangnähe erfolgt weiterer
Aufstieg!
|
|

|
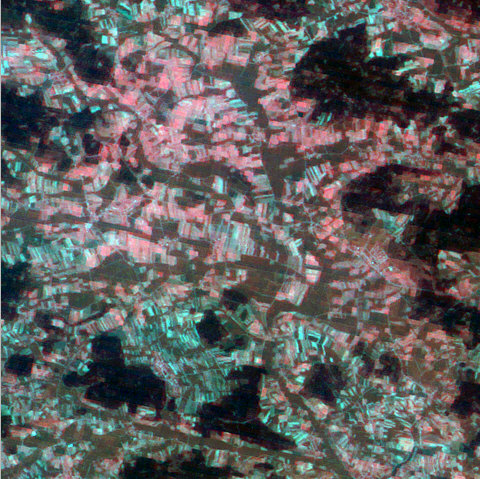
|
|
"Modell
Taubertalzirkulation" und ihre Übertragung auf Beckenlagen, hier:
Geslau-Colmberger Becken
|
Thermische
Unterschiede (Tagsituation) im Geslau-Colmberger Becken mit einem
Farbkomposit unter Verwendung des Thermischen Infrarotkanales von
LANDSAT sichtbar gemacht
|
|

|
Bodennahe
Inversion morgens gegen 7 Uhr im Geslau-Colmberger Becken
|
- Tag- und
Nachtzirkulation in einem Tal,
- der Einfluss der
Exposition und der Bodenbedeckung auf das Mikroklima
- der Einfluss von
Gewässern (-> Modell für maritime, kontinentale Effekte im
Großraum)
... und wie
geht es im Unterricht weiter?
Die Aufarbeitung
durch den Lehrer in Form von HTML-Seiten selbst ist unbefriedigend aus
mindestens zwei Gründen:
- die
zeitmässig beschränkte Beteiligung der Schüler an der
Auswertung einerseits und
- der nur mangelhaft
direkt ersichtliche mögliche räumliche Bezug anderseits.
Hier muss man nun
bei GIS-Techniken bzw. GIS-Programmen ansetzen:
- GIS
ermöglicht durch Rasterdaten die Einbindung von Fotos, Karten,
Luft- und Satellitenbildern,
- im Overlay mit der
Verteilung der Messstationen im Gelände
- die Darstellung
der Messergebnisse gebunden an die Stationen in Diagrammen sowie
- in Verbindung mit
Spezial-GIS-Programmen die Erzeugung von Hangneigungs- und
Expositionskarten aus in SchulGIS anhand der Digitalisierung der
Höhenlinien erzeugten DGMs
Die Konsequenz ist
daher eine Unterrichtseinheit über grundlegende Techniken von
GIS-Programmen am Beispiel des Taubertalprojektes:
- Digitalisierung
der Höhenlinien der TK 1:25000 von Tauberzell in
Gruppenarbeit
- Nutzungskartierung
Tauberzell (Rebflächen bereinigt/unbereinigt, Steinriegel, Wald,
Ackerfläche) in Gruppenarbeit und anschließender
Zusammenführung in einem Layer
- Kartierung der
ersichtlichen Erosionserscheinungen anhand eines Luftbildes
|