von Kurator Oliver
Sänger M.A.
Trotz der beeindruckenden Anzahl von 400 Objekten auf einer
rund 900 qm großen Ausstellungsfläche ist es ein gewagtes
Unternehmen, die lange Zeit von 900 Jahren badischer Landesgeschichte
in einer Ausstellung darzustellen. Aber wollte man wirklich die „gesamte“ Geschichte
erzählen, müsste man unweigerlich scheitern.
Deshalb war eine Orientierung notwendig, sowohl bei der Entwicklung
eines Konzepts, als auch bei der Auswahl der Objekte und der
Gestaltung der Ausstellung selbst.
|
|

"Roter Teppich" zur Urkunde mit der ersten Erwähnung des
"Markgrafen von Baden" (1112, Staatsarchiv Bamberg) |
Zwei wichtige Leitlinien standen dabei im Vordergrund:
1. Chronologie: Der Besucher kann in der Ausstellung einen Gang
durch die Landesgeschichte Badens unternehmen, von der erstmaligen
Erwähnung des Titels „Markgraf von Baden“ im
Jahr 1112 bis zur Gegenwart – und der Frage, was Baden
heute noch ist. Die Ausstellung ist in neun thematische Einheiten
gegliedert, die jedoch nicht immer einem Jahrhundert entsprechen.
Vielmehr liegt ein Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert, dem vier
der neun Einheiten gewidmet sind.
2. Geschichten erzählen: Die Ausstellung erzählt die
Landesgeschichte in Form einzelner Geschichten, die von wichtigen
Ereignissen oder herausragenden Persönlichkeiten handeln,
sich aber auch mit Vorstellungen und Stereotypen über Baden
beschäftigen. Eine solche Geschichte umfasst jeweils etwa
vier bis sechs Objekte und soll vom Besucher als Einheit wahrgenommen
werden.
Durch die Ausstellung…
Wusstest du, dass Uhu aus Baden kommt? Sind Bollenhut und Kuckucksuhr
typisch badisch? Am Eingang der Ausstellung empfängt den
Besucher ein offener Raum, an dessen Wänden ihn einige Statements
zum Nachdenken über sein eigenes Bild von Baden anregen
sollen: Welche Ideen und Vorstellungen bringt der Besucher mit?
Wird er sein Baden-Bild in der Ausstellung bestätigt finden
oder entdeckt er Neues, Überraschendes, ihm Unbekanntes?
Ein „Roter Teppich“ führt den Besucher direkt
zu dem Objekt, das uns den Anlass für das Landesjubiläum
und die Große Landesausstellung lieferte: Das Original
der Kaiserurkunde aus dem Jahr 1112 mit der erstmaligen Erwähnung
eines „Markgrafen von Baden“.
|
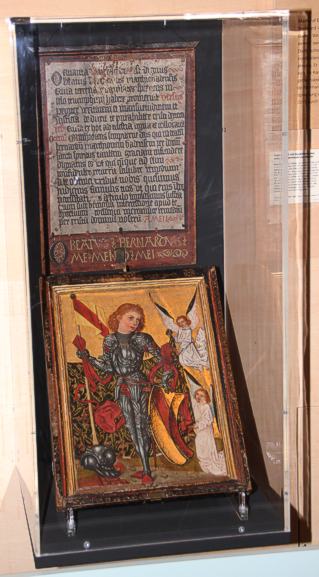
Votivtafel mit einer der frühesten Darstellungen
des Seligen Bernhard von
Baden
Oberrhein, 1480-1484.
Haus Baden
|
|
Bevor der Besucher nun seine Reise in die 900-jährige Geschichte
startet, fällt ihm vielleicht noch eines ins Auge: Die Ausstellungsarchitektur.
Er sieht eine Architektur, deren natur belassene Holzwände
sinnbildhaft für Schlichtheit und Bodenständigkeit
stehen – Charaktereigenschaften, die den Badenern oft von
außen zugeschrieben werden und die sie auch gerne für
sich in Anspruch nehmen. Das zweite prägende Element der
Ausstellungsarchitektur sind die Blenden vor den Vitrinen: Sie
sind farblich den neun Ausstellungsgruppen zugeordnet, so dass
eine Orientierung erleichtert wird. Die modernen Farben der Blenden
entsprechen der Innovation und dem stetigen Wandel, die den Verlauf
der badischen Geschichte bestimmt haben.
Die erste Ausstellungsgruppe „Die Markgrafschaft – Ursprung
und Ausbau“ beschäftigt sich mit der Entwicklung Badens
im Mittelalter. Zentral im Raum steht die Inszenierung eines „Burgbergs“ mit
den drei wichtigsten Burganlagen der Markgrafen von Baden: die
Namen gebende Burg Hohenbaden bei Baden-Baden, die Hochburg bei
Emmendingen, und die Burg Rötteln bei Lörrach. Zentrale
Objekte dieser Gruppe sind ein Messkelch aus der Stiftskirche
Baden-Baden und das sogenannte Pfälzer Lehenbuch aus dem
Generallandesarchiv Karlsruhe, das aus konservatorischen Gründen
allerdings nur für drei Monate im Original gezeigt werden
kann. Diese beiden Objekte stehen für den Aufstieg und Fall
der Markgrafen von Baden im Mittelalter.
Aus dem Besitz des Hauses Baden kommt eine auf 1490-1494 datierte
Votivtafel mit einer der ältesten bildlichen Darstellungen
des seligen Bernhard von Baden. Und schließlich dokumentiert
ein Teil einer romanischen Türlaibung aus dem Alten Schloss
in Stuttgart, die noch immer Erstaunen hervorrufende Tatsache,
dass die württembergische Residenz eine Gründung der
Markgrafen von Baden ist.
Die zweite Ausstellungsgruppe trägt den Titel „Geteiltes
Land – entzweit und wiedervereint“, hier geht es
um die Zeit der badischen Landesteilung zwischen 1535 und 1771.
Höhepunkt dieses Ausstellungsbereichs ist die sogenannte „Markgrafentafel“ von
Hans Baldung gen. Grien von 1509/10 aus der Staatlichen Kunsthalle
Karlsruhe, ein Objekt, das dieses Haus normalerweise nicht verlässt.
Zu Ehren des Landesjubiläums wurde eine Ausnahme gemacht,
da die „Markgrafentafel“ in der Großen Landesausstellung
hier in ihrem historischen Kontext gezeigt werden kann: als ein
Schlüsseldokument für die badische Landesteilung.

Streitobjekt in der Vergangenheit und bedeutendes Werk der
badischen Geschichte: Die Markgrafentafel, ein Werk Hans Baldung
Griens von 1509/10. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Außergewöhnlich schön sind die Blätter
aus einem der wenigen erhalten gebliebenen „Tulpenbücher“ des
Karlsruher Stadtgründers Markgraf Karl Wilhelm.
In der Ausstellung werden allerdings nicht die bekannten Motive
aus dem Band gezeigt, der sich in der Badischen Landesbibliothek
befindet, sondern die weithin unbekannten Darstellungen aus dem
Besitz des Generallandesarchivs. Diese Handzeichnungen sind in
ihrer originalen Farbigkeit bis heute erhalten geblieben, weshalb
aus konservatorischen Gründen jeweils nur ein Blatt im monatlichen
Wechsel gezeigt werden kann. Ins Auge springt schließlich
in dieser Gruppe noch ein Diorama, das den Bau einer Schanze
zur Zeit des „Türkenlouis“ genannten Markgraf
Ludwig Wilhelm zeigt. Es wurde gefertigt von der AG MINIFOSSI,
einer Arbeitsgemeinschaft der Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim,
die sich seit Jahren mit großem Engagement der Erforschung
der Schanzen und Linien des Türkenlouis im Schwarzwald widmet.
Der dritte Ausstellungsbereich „Baden in Bewegung – Reformen,
Recht und Reaktionen“ beginnt mit einem Modell des Karlsruher
Ständehauses, des zentralen Orts der politischen Entwicklung
Badens im 19. Jahrhundert. Bei diesem Thema dürfen natürlich
die badische Verfassung, der Liberalismus und die Revolution
von 1848/49 nicht fehlen.
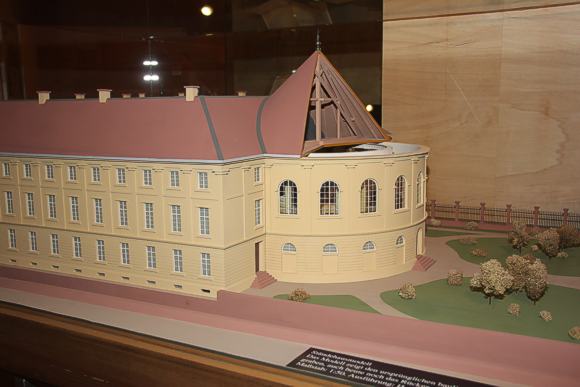
Modell des 1944 zerstörten Ständehauses, Sitzungsort des badischen
Landtags
Der Blick des Besuchers soll aber auch auf weniger bekannte
oder schwierige Aspekte der Geschichte des 19. Jahrhunderts gelenkt
werden. So nimmt eine englische Karikatur die bisweilen grotesk
anmutenden Umstände der Gründung des Großherzogtums
Baden von Napoleons Gnaden gezielt aufs Korn. Ein „alemannisches“ Fastnachtskleid
aus Venezuela bringt ein Stück Baden aus der Fremde in die
Ausstellung, und eine patriotische Bronzefigur aus der Zeit des
Krieges von 1870/71 belegt, dass nationalistische Überlegenheitsgefühle
auch in Baden Verbreitung fanden. Schließlich ist der Stab
des Freiburger Erzbischofs Hermann von Vicari ein eindrucksvolles
Dokument für den sogenannten „Kulturkampf“,
die Auseinandersetzung des liberalen Staats mit der katholischen
Kirche.
Erfindungen aus Baden bilden den Schwerpunkt des vierten Teils „Stadt-Land-
Fluss – Innovationen im langen 19. Jahrhundert“.
Hier ist die Laufmaschine von Karl Drais in einer historischen
und einer modernen Variante zu sehen, eine Medienstation macht
die erste Fernfahrt mit einem Automobil durch Bertha Benz für
den Besucher erfahrbar, und ein Stoffdruckmodel steht für
die Anfänge der Industrialisierung. Bekannte Marken aus
Baden wie Rothaus, Maggi, Gütermann, Uhu und Vivil sind
vertreten, aber auch die Werbung für diese Marken: Historische
Glasplakate und Emailschilder, die in Offenburg und Ortenberg
produziert wurden, wo sich bis ins 20. Jahrhundert ein Zentrum
der Werbemittelindustrie befand.
Bekannte Namen wie Johann Peter Hebel, Heinrich Hansjakob oder
Hermann Hesse sind im fünften Bereich der Ausstellung „Kultur-Land
Baden – erlesen und anregend“ zu finden.
Johann Peter Hebel ist eine für die badische Identität
prägende
Figur, denn mit seinen „Alemannischen Gedichten“ machte
er den Dialekt salonfähig. In einer Hörstation ist
der Sprachklang dieser Gedichte zu hören – für
Nicht-Badener auch auf Hochdeutsch. Heinrich Hansjakob, Pfarrer
und Volksschriftsteller, war zeitlebens ein unbequemer Kopf.
Die Ausstellung präsentiert eine Büste, die er sich
eigens anfertigen ließ. Sie zeigt eine Personifikation
der römisch-katholischen Kirche – blind, taub und
stumm! Und auch Hermann Hesse darf im Kanon der kulturellen Landesvertreter
nicht fehlen. In seinem Refugium in Gaienhofen am Bodensee war
er von der Menge der ihm unerwünscht zugesandten Schriften
so genervt, dass er eine originelle Art der „Entsorgung“ erfand:
Ein Bodenschnitt durch einen Gartenweg beweist, dass sie dort
als „literarisches Fundament“ dienten.
Eine große Wand voller Kuckucksuhren bildet den Blickfang
im sechsten Themenbereich „Baden bunt – Blick hinter
die Klischees“ und liefert damit ein sicher vielen Besuchern
aus zahlreichen Souvenirshops des Schwarzwalds bekanntes Bild.
Doch ist die Kuckucksuhr wirklich so typisch für den Schwarzwald?
Was auf den ersten Blick eindeutig erscheint, hinterfragt ein
Blick auf die Entstehungsgeschichte. Gleichzeitig dokumentieren
moderne Uhren des Offenburger Künstlers Stefan Strumbel
und des Schwarzwälder Traditionsherstellers Rombach & Haas,
dass Kuckucksuhren auch ganz anders aussehen können. In ähnlicher
Form werden in der Ausstellung weitere Klischees und Stereotypen
hinterfragt: Die Trachten (mehr als nur Bollenhut), der Bollenhut
selber (eigentlich ein Württemberger), das Badnerlied (eigentlich
ein Soldatenlied), und Kaspar Hauser (wahrscheinlich kein badischer
Prinz).
Im siebten Teil „Grenzlage – Ankommen im 20. Jahrhundert“ ist
ein zentrales Exponat aus der Dauerausstellung des Badischen
Landesmuseums in einem veränderten Kontext zu sehen. Die
großherzogliche Krone, ansonsten im Thronsaal zu finden,
verpackt im Koffer. Die Monarchie ist zu Ende, Baden wird Republik.
In der Zeit der sogenannten „Weimarer Republik“ herrschten
in Baden weitgehend stabile 4 politische Verhältnisse, vielerorts
machte sich Aufbruchstimmung breit. Im Bereich der Architektur
und des Städtebaus versinnbildlichen diese Aufbruchstimmung
die neuen Gartenstädte und insbesondere die Dammerstock-Siedlung
in Karlsruhe. Sie und die Gartenstadt Freiburg-Haslach sind in
der Ausstellung durch Architekturmodelle vertreten, die eigens
für diesen Anlass von Studenten der Hochschule Karlsruhe – Technik
und Wirtschaft angefertigt wurden.
Auch das dunkelste Kapitel badischer Geschichte wird in der
Ausstellung nicht ausgespart: die Zeit des Nationalsozialismus.
In Baden ging es keineswegs „liberaler“ zu als in
anderen Teilen Deutschlands. „Zwischen Tätern und
Opfern“ ist dieser achte Themenbereich überschrieben,
der sich beiden Sichtweisen zuwendet. Einen Blick auf die Täter
wirft die Geschichte der beiden prominentesten badischen Nationalsozialisten
Robert Wagner und Walter Köhler, deren verschiedene Schicksale
exemplarisch aufzeigen, wie unterschiedlich mit den Tätern
nach der NS-Zeit verfahren wurde: Der Eine wurde kurz nach Kriegsende
zum Tode verurteilt und hingerichtet, der Andere kam durch die
Entnazifizierung und wurde später ein erfolgreicher und
angesehener Geschäftsmann. Beklemmung lösen Exponate
wie das Ausgangsbuch der Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen
aus, in dem ab 1940 mit dem nüchternen bürokratischen
Vermerk „verlegt im Zuge planwirtschaftlicher Maßnahmen“ die
Patienten aufgelistet sind, die im Rahmen der sogenannten „Euthanasie“-Maßnahme
zur Ermordung bestimmt waren. Gezeigt wird zudem ein Häftlingsgeschirr
aus dem KZ-Außenlager Haslach im Kinzigtal, welches die
primitiven Lebensumstände dokumentiert, unter denen viele
Häftlinge den Tod fanden.
Die Vereinigung der Länder Baden und Württemberg zum
neuen Südweststaat 1952 ist schließlich eines der
Themen im neunten und letzten Ausstellungsbereich „Dasein
im deutschen Südwesten – Badische Identitäten“.
In einer Hörstation kommt mit dem damaligen (süd-)badischen
Staatspräsidenten Leo Wohleb der wohl prominenteste und
vehementeste Kämpfer für ein selbständiges Land
Baden zu Wort. Und was kann nach 1952 noch an „badischen“ Geschichten
erzählt werden? In den 1970er Jahren waren die Erfahrungen
Badens als Grenzland sicherlich auch bestimmend für den
Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl in Südbaden.
Nachvollziehen kann der Ausstellungsbesucher dies dank einer
Hörstation, in der Teilnehmer des damaligen Protestes von
ihren Beweggründen erzählen. Schließlich wartet
die Ausstellung an ihrem Ende nochmals mit einem Höhepunkt
auf: Mit Porträts des badischen Unternehmerpaares Franz
und Aenne Burda von Andy Warhol.
Am Ende der Ausstellung sind noch einmal die Besucher gefragt,
wenn die eingangs gestellte Frage nach ihrem Bild von Baden wieder
aufgegriffen wird: Es erwartet sie eine Wand mit Monitoren, auf
denen zu sehen – und über Kopfhörer auch zu hören – ist,
was heutige Badener und nicht-Badener über den Landesteil
im Südwesten denken. Diese Statements wurden bereits im
Vorfeld der Ausstellung in der „Baden-Box“ aufgezeichnet,
die über mehrere Wochen im Einkaufszentrum „Ettlinger
Tor“ in Karlsruhe stand. Für die Dauer der Ausstellung
wird sie im „Baden-Forum“, dem museumspädagogischen
Aktionsraum zu finden sein. Dort können alle Besucher ihre
eigene badische Geschichte erzählen. Originelle, geistreiche,
witzige, hintergründige, eben „typisch badische“ Beiträge
haben eine gute Chance, in die Monitorwand aufgenommen und somit
Teil der Ausstellung zu werden.
|