|
Die erste flächendeckend angelegte schriftliche Befragung
zur Erfassung historischer und zeitgenössischer Volkskultur
im deutschen Kaiserreich wurde 1893-1896 durch die Freiburger
Hochschullehrer Fridrich Pfaff (1855-1917), Elard Hugo Meyer
(1837-1908) und Friedrich Kluge (1856-1926) im Großherzogtum
Baden durchgeführt. Die Altertums- und Sprachforschung hatte
schon seit dem Wirken der Brüder Jakob (1785-1863) und Wilhelm
Grimm (1786-1859) die verborgenen Reste deutscher Volkskultur
ins Visier genommen und die Freilegung alt überlieferter
Schätze und Quellen postuliert. Maler, Poeten, Mythologen
und Theologen erkannten den Wandel der zeitgenössischen
Kultur und beklagten die Gefährdung des vertrauten ländlichen
Raums durch neue unüberschaubare Lebensformen.
Von dem Freiburger
universitären Triumvirat pflegte Fridrich Pfaff, der später
zum Gründer und ersten Vorsitzenden des Landesvereins Badische
Heimat wurde, den unmittelbaren Zu- und Umgang mit der sogen.
Volkskultur, während Kluge und Meyer eher die akademische
Studierstube bevorzugten. Für ihr gemeinsames Fragebogenprojekt
in Baden griffen sie auf Vorgaben des Germanisten und Volkskundlers
Karl Weinhold (1823-1901) zurück, der in der ersten Ausgabe
der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 1891 den neuen
volkskundlichen Kanon definiert hatte. Mit Ausnahme der damals
aktuellen phänotypischen Kategorien (Schädelmorphologie,
Knochen- und Körperbau, Physiognomie) übernahm die
Forschergruppe weitgehend das vorgegebene Erhebungsmuster.
Nach
einem ersten, privat getragenen und wenig erfolgreichen Feldversuch
bediente man sich bestehender staatlicher
Verwaltungsstrukturen. 1500 Schulorte in Baden wurden mit einem
allgemeinen Fragebogen bedacht, für die Erfassung des religiös-kirchlichen
Kulturraumes richtete sich ein besonderer Bogen an die örtlichen
Pfarrer. Insgesamt wurden 3000 Bögen ausgegeben und über
die Kreisschulämter an die Gewährsleute verteilt. Zur
Gewinnung der von den Organisatoren erwünschten Erhebungsdaten
wurden die beteiligten Pädagogen und Theologen in besonderen
Kursen in Freiburg auf ihre Feldbeobachtung vorbereitet. Viele
Lehrer waren ohnehin schon eifrig auf dem Gebiet der Heimatpflege
tätig. Unverkennbar jedenfalls spiegeln sich in vielen Antworten
der handschriftlich ausgefüllten Fragebögen die gedanklichen
Konstrukte ihrer Autoren Kluge, Meyer und Pfaff wider. So diente
das gewonnene Datenmaterial auch der Untermauerung bereits bestehender
wissenschaftstheoretischer Fachpositionen.
Dank zahlreicher Kontakte
und persönlicher Beziehungen der drei Feldforscher erzielte
die Umfrage einen beachtlichen Rücklauf von annähernd
600 mehr oder weniger umfangreich beantworteten Fragebögen – diese
Quote von ca. 20 Prozent gilt auch nach heutigen Maßstäben
als erfolgreiche Datenbasis. Elard Hugo Meyer hat als einziger
der beteiligten Wissenschaftler schon bald die neu gewonnenen
Quellen aus seinen Schwerpunktthemen Sitte und Brauch ausgewertet
und publiziert (E.H. Meyer: Badisches Volksleben im 19. Jahrhundert.
Straßburg 1900).
Die anderen Themenbereiche des Fragebogens
(Namenkunde, Hausbau, Handwerk, Gewerbe und Alltagsleben (Fridrich
Pfaff), insbesondere aber der umfangreiche Abschnitt zur sprachlichen Überlieferung
(Friedrich Kluge) blieben – mit Ausnahme einzelner lokaler
Quellenauswertungen – bis heute unbearbeitet. In der Wissenschaft
wurde die badische Fragebogenerhebung von 1894 jedoch rasch bekannt
und diente weiteren Projekten zur Erfassung regionaler Volkskultur
als erprobte Vorgabe (Württemberg, Bayern).
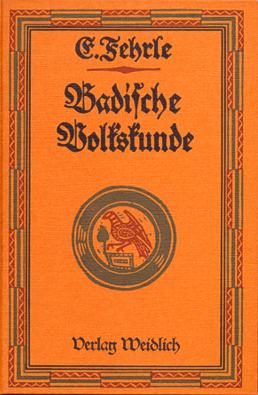 Das umfangreiche
badische Fragebogenmaterial verblieb in den folgenden Jahrzehnten
im Besitz des Freiburger Badischen Vereins für Volkskunde
und dessen Rechtsnachfolger Landesverein Badische Heimat. Später
muss das Archivgut von Freiburg an den Lehrstuhl für Volkskunde
(Eugen Fehrle) der Universität Heidelberg gelangt sein.
Nach der Zerstörung dieses Instituts hat in den ersten Nachkriegsjahren
der Freiburger Volkskundler Johannes Künzig (1897-1982)
wesentliche Teile der Fragebogensammlung „mit eigenen Händen
aus dem Bombenschutt“ geborgen und in seine 1960 in Freiburg
gegründete staatliche Badische Landesstelle für Volkskunde
verbracht. Ein kleineres Konvolut von 68 originalen Fragebögen
befindet sich im Bestand der Forschungsstelle Badisches Wörterbuch
des Deutschen Seminars der Universität Freiburg. Das umfangreiche
badische Fragebogenmaterial verblieb in den folgenden Jahrzehnten
im Besitz des Freiburger Badischen Vereins für Volkskunde
und dessen Rechtsnachfolger Landesverein Badische Heimat. Später
muss das Archivgut von Freiburg an den Lehrstuhl für Volkskunde
(Eugen Fehrle) der Universität Heidelberg gelangt sein.
Nach der Zerstörung dieses Instituts hat in den ersten Nachkriegsjahren
der Freiburger Volkskundler Johannes Künzig (1897-1982)
wesentliche Teile der Fragebogensammlung „mit eigenen Händen
aus dem Bombenschutt“ geborgen und in seine 1960 in Freiburg
gegründete staatliche Badische Landesstelle für Volkskunde
verbracht. Ein kleineres Konvolut von 68 originalen Fragebögen
befindet sich im Bestand der Forschungsstelle Badisches Wörterbuch
des Deutschen Seminars der Universität Freiburg.
Rechts: Die "Badische Volkskunde" des Heidelberger Professors
Eugen Fehrle von 1924, Nachgedruckt 1979. |