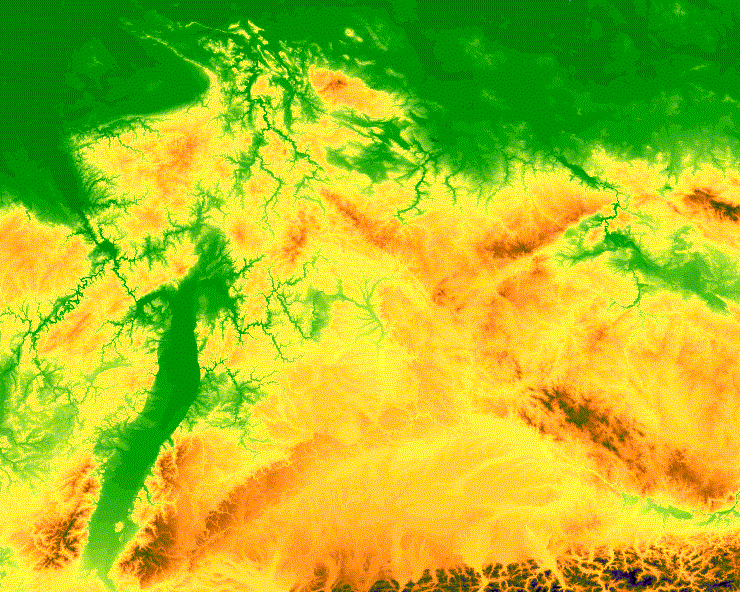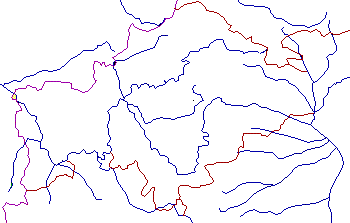|
Entstehung des Taubertales (Reliefgenese)
Taubertal bei Tauberscheckenbach/Tauberzell (April 2003)
|
|
|
Taubertal bei Tauberscheckenbach/Tauberzell (April 2003)
|
|
Aufgabe:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
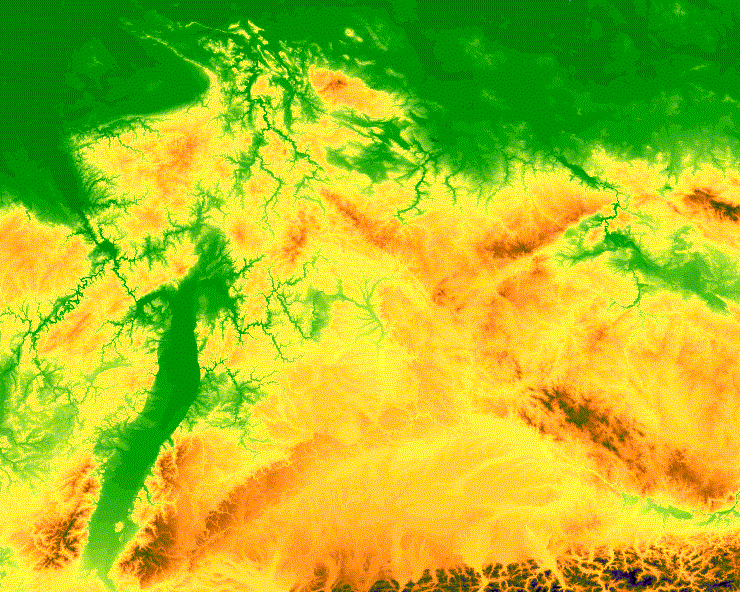
|
|
Reliefkarte von Süddeutschland (ohne Höhenangaben!), erzeugt aus den GTOPO3.0-Daten des USGS mit dem Programm 3demfly.
Aufgaben:
Unterstufe:
Eine eigenartige Karte!
1. Bezeichne die in der obigen Karte erkennbaren Täler mit den Namen der Flüsse!
2. Bezeichne die in der obigen Karte erkennbaren Mittelgebirge!
3. Suche das Ries!
4. Versuche mit Hilfe des Atlas in das Arbeitsblatt möglichst genau die Lage Rothenburgs einzuzeichnen!
Lösung:
Oberstufe:
Hier findest Du/finden Sie eine stark vereinfachte geologische Zeittabelle
|
|
Quellentext:
|
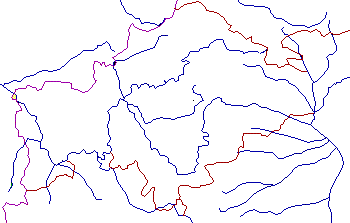
|
Die Tauber "besitzt nach FUGMANN (1988) ein Einzugsgebiet von 1.809,5 km2 Größe. Ihre Quelle liegt auf der Ostabdachung der Hohenloher Ebene im Vorland der Frankenhöhe bei ca. 455 m ü. NN. Von dort aus fließt sie zuerst in der Subsequenzzone der Keuperstufe, dann erfolgt südlich Rothenburg eine starke Eintiefung um ca. 65 m in den Oberen Muschelkalk ..." (SPONHOLZ, 1997, a.a.O. S.51)
Die tertiäre und pleistozäne Reliefgenese im Bereich des Taubertales scheint eng verknüpft zu sein mit den Bewegungen der sog. "Süddeutschen Großscholle" sowie tektonischen Verbiegungen.
Einen Überblick über den Forschungsstand über die post-jurassische Landschaftsentwicklung ... gibt (KURZ, 1988, a.a. O. S. 18 ff)
Die Korrelation älterer Terrassen entlang der Flussläufe von Jagst und Kocher, die dem Rhein über den Neckar tributär sind und den Terrassen der Tauber, die über den Main ebenfalls dem Rheint tributär sind infolge der tektonischen Bewegungen in den Abflussgebieten und ihren Vorflutern, unterschiedlicher Zeitpunkte der Umstellung der Entwässerungsrichtungen mehr als fraglich. (vgl. ....)
|
|
Der Main und seine Nebenflüsse - erzeugt mit unveröffentl.
Programmentwurf "Geograph-Karte" (DOS-TurboPascal)
Aufgabe:
Arbeitsblatt:
|
"Für das Tal der dem Main tributären Tauber gibt JUNGBAUER (1983) in Anlehnung an CARLE (1973) folgende Terrassensequenz an:
- 100 bis 160 m über dem Fluß vermutlich pliozäne Höhenschotter zwischen Igersheim und Schäftersheim
- 50 bis 70 m und 20 bis 30 m über dem Fluß altpleistozäne Terrassen.
- 5 bis 10 m über dem Fluß lößbedeckte Riß-Terrassen
würmeiszeitliche Kiessande der Tauber im Bereich der Talsohle und wenig darüber" (SPONHOLZ, 1997, a.a.O. S.51).
Die Maintalbildung unter besonderer Berücksichtigung der Terrassen untersuchen u. a. (KÖRBER 1962, HEIM 1979, ...)
|
| |
| |
|
Ein älterer Beitrag mit Bildern zur Entstehung des Maintales (Einleitung zu einer Zulassungsarbeit aus dem Jahr 1979) |
| |
| |
|
|
|
|

|

|
|
Hangverflachungen, die Terrassen der Nebenflüsse der Tauber oberhalb der Niederterrasse sein könnten, sind an mehreren Nebenflüssen der Tauber - wie hier an ... bei ... beobachtbar. Bei einer Geländebegehung im Rahmen der Facharbeit von Ralf Hahn wurden bei Tauberzell auch Windkantern auf Kalkstein beobachtet (Photo hinzufügen!)
|
Durch ... sind hier bei ... zwei unterschiedliche Terrassenniveaus aufgeschlossen: ...
|
|

|

|
|
Selbst das nur mit ... km sehr "kurze" Vorbachtal als Nebenfluss der ... bildet eine deutliche "Niederterrasse" aus.
|
Diese erscheint in manchen Abschnitten durchaus zweigeteilt, wie hier bei dieser "Kaskade" des Vorbaches.
|
|
Das Taubertal bei Tauberzell
|

|

|
|
|
|
|
Zwischen Tauberzell und Tauberscheckenbach sowie nördlich von Tauberzell begleitet beidseits der Tauber mit einem deutlichen Hangknick an der Oberkante eine mit rund ... zum Talboden einfallende Verebnung im Höhenbereich von ca. bis ca. den Unterhangbereich des Taubertales, die offensichtlich später wiederum unterschnitten wurde. Zunächst drängt sich die mögliche Interpretation als eine Taubertalterrasse auf.
|
Auf der Oberfläche findet man zahlreiche an Windkanter erinnernde Kalksteine. Windkanter auf Kalk wurden von ... beschrieben. Wenn es sich also bei diesen Gesteinen um Windkanter handeln würde und nicht um Scherben, die Reste einer in dem Gebiet vorhandenen intensiven Verkarstung wären, dann würden diese belegen, dass diese "Verebnung" während der letzten Kaltzeit bereits bestanden hat, da Windkanter in unseren Regionen allgemein als Zeugnis einer Kaltzeit angesehen werden.
|
|

|

|
|
Ein im letzten Jahr infolge der Anschlussmaßnahmen an eine zentrale Kläranlage erfolgter Anschnitt der Hangkante westlich des Sportplatzes zeigt allerdings, dass es sich bei den Sedimenten ausschließlich um kantigen Muschelkalkschutt handelt, der wie auf dem rechten Bild zu erkennen ist durchaus die Dimension von einem Meter erreichen kann. Hierbei muss es sich um sog. Solifluktionsschutt aus den steileren oberen Hangbereichen handeln.
|
Dieser Solifluktionsschutt trägt einen gut ausgeprägte (allochthone oder autochthone Boden (Braunerde). Da der Hangschutt in diesen Bodenbereich bis fas unter die Oberfläche hineinricht, könnte es sich durchaus um eine autochthone Bodenbildung handeln, auch wenn das Relief dagegen spricht.
|
|

|
|
|
Im südwestlichen Teil dieses Aufschlusses erkennt man oberhalb des heutigen Tauberniveaus mindestens zwei ältere Terrassenkanten, die sich mit dem Hangschutt "verzahnen". Geht man von den als Windkantern interpretierten Gesteinen der das Tal begleitenden Fläche aus, berücksichtigt man die Höhenlage dieser Fläche, so müsste diese mindestens früh- bis hoch-würmzeitlich sein, da der Betrag der Einschneidung in den Talschutt nach üblicher Anschauung in Warmphasen erfolgt. Anders wäre es, wenn es sich um eine "Überschüttung" des oberen Terrassenniveaus im Bild handeln würde. Dies konnte aber mangels Aufschluss nicht beobachtet werden, um die Frage zu klären.
|
|
|
|
Die Talränder der Tauber sowie die Flächen beidseits der Tauber weisenP in den durch Muschelkalk geprägten Gebieten zahlreiche Dolinen unterschiedlicher Größe und Gestalt auf.
|

|

|
|
Unregelmässig geformte Doline bei
Bettenfeld im südlich des Schandtaubertales.
Hier konnte im Frühjahr 2002 im Untergrund
das Geräusch fließenden Wassers festgestellt
werden.
|
Eine regelmäßige, kreisrunde Form
zeigt diese unter Waldbedeckung vorzufindende Doline bei ...
|
|

|
SPONHOLZ (1997 a. a. O S. 101 ff) verweist auf zahlreiche, nach der Größe und auch der Relieflage bereits im Endtertärtär bereits angelegte Großdolinen, die später durch eingeschwemmte Sedimente plombiert und verfüllt wurden. Der Lk Ek 1998/2000 konnte bei einer Bohrung im Rahmen eines Gelände- und Laborpraktikums im Herbst des Jahres 1998 bei der Probennahme durch der plombierten Großdoline durch Herrn Dr. Erhard Schulz und ... teilnehmen. Im anschließenden Laborpraktikum, an dem der Autor zeitweise teilnehmen konnte, wurde festgestellt, dass das Material der Verfüllung die gesamte quartäre Landschaftsgeschichte der Umgebung seit dem Ende der Würmeiszeit dokumentiert. (Einfügen von Bildern vorgesehen!)
|
|
Doline bei ... Dass diese
Doline noch aktiv ist, konnte im Frühjahr 2002 an frischem, nachgestürztem Material beobachtet werden.
|
|

|
|
Die holozäne Talgeschichte wurde mit der Arbeit über "Die morphogenetische Wirksamkeit historischer Niederschläge" von HAHN,H.-U.(1992) am Beispiel der Besselbergäcker und der Grünbachau im unteren Taubertal beispielhaft aufgearbeitet. HAHN (1992) unterscheidet für den dortigen Beispielshang neben allgemeinen ... , regional beschränkten extremalen Wetterereignissen, sogeannanten "Events" durch die Untersuchungen GLASERS ... belegt folgende durch den Menschen beeinflusste Phasen der " quasinatürlichen Rahmenbedingungen wie Relief- und Bodenverhältnisse:
1. Die Periode der neolithischen bis keltischen Landnutzung.
2. Das Frühmittelalter mit dem beginnenden Wein- und Getreideanbau.
3. Die Periode vom Hochmittelalter bis zur Frühneuzeit mit intensiviertem Landbau sowie durch Verbauung und Terrassierung
der Reblagen.
4. Das 19. Jahrhundert mit der Besömmerung der Brache und der sukzessiven Aufgabe des Weinbaus.
5. Wiederbewaldung der Unterhänge und moderne Fruchtwechselwirtschaft an Ober- und Mittelhang in diesem Jahrhundert. " (HAHN, 1992, S. 40 ff)
HAHN relativiert hiermit insofern die Übertragbarkeit von punktuell erhobenen Ergebnissen, als diese durch räumlich eng beschränkte Ereignisse einerseits beschränkt wird. Man erinnere sich nur an die in die 90-er Jahren regional stark durch Wiebke betroffenen Gebiete im Raum Rothenburg . Andererseits sieht HAHN die Entwicklung des Reliefs seit spätestens der neolithischen Landnutzung stark beeinflusst durch die jeweils bevorzugte Siedlungsaktivität und die vorherrschende Agrarwirtschaft. Insofern wäre es mehr als interessant an anderer Stelle des Taubertaleinzugsbereiches vergleichende Untersuchungen durchzuführen und Übereinstimmungen bzw. Abweichungen festzustellen.
Das Gebiet Tauberzell um Tauberzell erweist infolge der räumlichen Nähe zum Keltenoppidum Finsterlohr und der durch HAHN, R. (1988) dokumentierten Siedlungsgeschichte Tauberzells für vergleichende Untersuchungen mehr als geeignet, um eventuell übereinstimmende bzw. abweichende Formungsprozesse aufzuzeigen, die letztendlich nur e i n Beitrag zur Aufhellung der komplexen holozänen Reliefgenese sein könnte. Angesichts nur weniger jüngerer Untersuchungen in diesem Raum erscheint dies mehr als notwendig!
HEIM, 2004
|
|
Hier findest Du/finden Sie eine stark vereinfachte geologische Zeittabelle
|