Die Präsentation „Barock – Nur schöner
Schein?“ stellt Charakteristika der facettenreichen Epoche
in sechs Ausstellungsbereichen vor. Diese ordnen die Exponate
nach den Themen „Raum“, „Körper“, „Wissen“, „Ordnung“, „Glauben“ und „Zeit“.
Der Rundgang erstreckt sich über rund 1.200 qm auf zwei
Stockwerken im Museum Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen. Während
passend zur Entdeckung ferner Länder exotische Pflanzenornamente
an den Wänden emporranken, spiegeln sich die strenge Symmetrie
und die Sichtachsen barocker Gartenanlagen in den Bauelementen
der Ausstellungsarchitektur wider.
„Raum“
In der Barockzeit betreiben die Europäer eine frühe
Globalisierung und beginnen einen die Kontinente übergreifenden
Kulturaustausch. Neue Handelsrouten werden erschlossen, Güter
aus fernen Ländern gelangen in die alte Welt. Neue Eindrücke
und Erkenntnisse erweitern buchstäblich den Horizont.
 Einschneidende
Fortschritte in Schiffbau und Navigation sowie exaktere Karten
und Globen (Foto links: Erd- und Himmelsgloben) machen weite
Seereisen an die afrikanische und asiatische Küste sowie
nach Amerika erst möglich.
Monate-, teils sogar jahrelang sind die Schiffe unterwegs. Sie
bringen kostbare Waren wie Gewürze, Kaffee oder Porzellan
nach Europa. Gehandelt werden neben Luxusgütern aber auch
Sklaven für die beginnende Plantagenwirtschaft. Nicht nur
Kaufleute, sondern auch immer mehr Künstler, junge Adelige
auf Grand Tour, Gesandte, Pilger oder Missionare begeben sich
auf teils gefährliche und strapaziöse Reisen zu Lande
und zu Wasser. In ihrem Gepäck befinden sich Reiseberichte,
Karten, Taschengloben und sogar eigens für Reisen gefertigtes
Mobiliar oder Geschirr. Reiseberichte, Kunstwerke und Theaterkulissen
entführen jedoch nicht nur an wirklich existierende Ziele,
sondern auch fiktive Länder stehen hoch im Kurs. Ein bekanntes
Beispiel sind Gullivers Abenteuer in Liliput, mit denen der Schriftsteller
Jonathan Swift (1667-1745) der damaligen Gesellschaft den Spiegel
vorhält. Einschneidende
Fortschritte in Schiffbau und Navigation sowie exaktere Karten
und Globen (Foto links: Erd- und Himmelsgloben) machen weite
Seereisen an die afrikanische und asiatische Küste sowie
nach Amerika erst möglich.
Monate-, teils sogar jahrelang sind die Schiffe unterwegs. Sie
bringen kostbare Waren wie Gewürze, Kaffee oder Porzellan
nach Europa. Gehandelt werden neben Luxusgütern aber auch
Sklaven für die beginnende Plantagenwirtschaft. Nicht nur
Kaufleute, sondern auch immer mehr Künstler, junge Adelige
auf Grand Tour, Gesandte, Pilger oder Missionare begeben sich
auf teils gefährliche und strapaziöse Reisen zu Lande
und zu Wasser. In ihrem Gepäck befinden sich Reiseberichte,
Karten, Taschengloben und sogar eigens für Reisen gefertigtes
Mobiliar oder Geschirr. Reiseberichte, Kunstwerke und Theaterkulissen
entführen jedoch nicht nur an wirklich existierende Ziele,
sondern auch fiktive Länder stehen hoch im Kurs. Ein bekanntes
Beispiel sind Gullivers Abenteuer in Liliput, mit denen der Schriftsteller
Jonathan Swift (1667-1745) der damaligen Gesellschaft den Spiegel
vorhält.
Das Fremde übt im Barock eine große Faszination aus.
Nicht nur bisher unbekannte Gewürze und Speisen finden Eingang
in Europa, sondern auch exotische Motive, Pflanzenmuster und
Ornamente erfreuen sich großer Beliebtheit. Filigranes
Porzellan, Kunstwerke und Alltagsgegenstände spiegeln diese
Begeisterung in der Ausstellung wider. Barocke Stillleben aus
Früchten und Gemüse inspirierten die zeitgenössischen
Künstler Ori Gersht und Andrzej Maciejewski zu ihren Werken.
Eine Mitmachstation bietet den Besuchern die Gelegenheit, den
Duft ferner Länder zu schnuppern, der mit neuen Lebensmitteln
nach Europa kommt. Globen und Karten, eine Kutscheninszenierung,
ein Schiffsmodell, Reiseberichte und -utensilien holen die große
weite Welt ins Museum.
„Körper“
Unter der Überschrift „Körper“ widmet sich
die Ausstellung Schönheitsidealen und -rezepten, der Hygiene,
der Esskultur und der medizinischen Versorgung im Barock.
Im Barock gibt es kein einheitliches Schönheitsideal. Neben
einer Vorliebe für Üppigkeit existiert auch ein von
der Antike inspiriertes Ideal der Schlankheit. Maler stellen
schöne nackte Körper dar. Ein beliebtes Motiv sind
biblische Szenen wie der Heilige Sebastian, die büßende
Maria Magdalena oder Susanna im Bade, die körperliche Schönheit
mit Tugend verbinden.
 Eindrucksvolle
Beispiele kommen aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien und
den Königlichen Kunstmuseen Belgiens in Brüssel.
Auch eine zeitgenössische Interpretation reiht sich in den
Bilderreigen ein: Der niederländische Fotograf Hendrik Kerstens
setzt sich in seinen Arbeiten auf ironische Weise mit den Alten
Meistern auseinander (Bild rechts: © Hendrik Kerstens). Eindrucksvolle
Beispiele kommen aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien und
den Königlichen Kunstmuseen Belgiens in Brüssel.
Auch eine zeitgenössische Interpretation reiht sich in den
Bilderreigen ein: Der niederländische Fotograf Hendrik Kerstens
setzt sich in seinen Arbeiten auf ironische Weise mit den Alten
Meistern auseinander (Bild rechts: © Hendrik Kerstens).
Um den Schönheitsidealen nachzueifern, greifen Frauen und
Männer zu allerlei Tricks und modischen Accessoires. Durch
Korsetts und Rockunterbauten wird die Silhouette der Frau geformt
und die Taille betont. Männer erlangen die gewünschte
imposante Statur dank hoher Absätze, voluminöser Kleidung
und üppiger Perücken.
Sauberkeit spielt im Barock in den gehobenen Kreisen eine wichtige
Rolle. Aus Angst, dass durch Wasser gefährliche Krankheitserreger
in die Haut eindringen, ergreift man andere Hygienemaßnahmen:
Man reibt sich mit Tüchern ab, reinigt die Haare mit Puder
und parfümiert sich. Hemden werden oft gewechselt und müssen
makellos weiß sein. Gebadet wird zu medizinischen Zwecken
mit Badezusätzen. Bei manchen Schlössern entstehen
sogar Badehäuser als exklusive Stätten der Entspannung.
Auch bei den Essgewohnheiten wird der Unterschied zwischen Arm
und Reich deutlich. Der Barock ist geprägt durch verheerende
Hungersnöte und rauschhaften Überfluss. Raffinierte
Speisen in aufwändiger Präsentation auf überreich
gedeckten Tafeln an den Höfen stehen einer spärlichen
Küche bei der einfachen Bevölkerung gegenüber.
Auch neue Luxusgüter wie Tee, Kaffee und Schokolade bleiben
der Oberschicht vorbehalten. Unter dem Motto „Biersuppe
und Austernfrühstück“ bewundern die Besucher
unter anderem unterschiedliche Geschirrformen und das „Neue
Salzburgische Kochbuch“ aus dem Jahr 1719 zeigt, wie man
ungewöhnliche Leckerbissen wie Delphinpastete zubereitet.
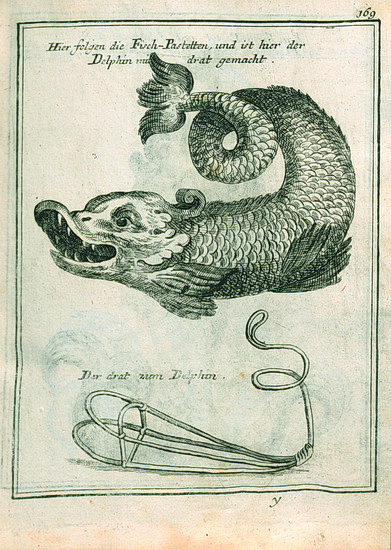
Conrad Hagger, Augsburg 1719,Drahtgestell für Delphinpastete
aus „Neues Saltzburgisches Koch-Buch“.
Kupferstich auf Papier.
Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. © Stadtbibliothek
Mainz
Ebenso wie bei der Esskultur richtet sich die medizinische Versorgung
nach gesellschaftlichem Rang und Vermögen. Am Hof und in
der Stadt ruft man den Arzt, auf dem Land geht man zum Barbier
oder behilft sich mit überlieferten Hausmitteln. Die Entdeckung
des Blutkreislaufes und Erkenntnisse aus der Anatomie verändern
die Medizin. Doch obwohl sie ihre theoretische Grundlage verloren
haben, halten sich Methoden wie Aderlass oder Schröpfen
noch lange. „Wissen“
Technische Innovationen des 17. und 18. Jahrhunderts ermöglichen
bahnbrechende Entdeckungen. Mit Fernrohren werden Sterne und
Weltraum erforscht, Mikroskope eröffnen Einblicke in die
für das bloße Auge unsichtbaren Welten des Allerkleinsten.
Galileo Galilei (1564- 1641/1642) erforscht die Gestirne, William
Harvey (1578-1657) entdeckt den Blutkreislauf, Antoni van Leeuwenhoek
(1632-1723) beobachtet im menschlichen Speichel Bakterien und
Isaac Newton (1643-1727) beweist die Gesetze der Schwerkraft.
Neben Traktaten präsentiert die Ausstellung zahlreiche wissenschaftliche
Instrumente, die den Fortschritt in der Barockzeit deutlich machen.
Darunter befindet sich eine wahre Rarität: eines der wenigen
erhaltenen Mikroskope von Antoni van Leeuwenhoek. Der vermögende
Tuchhändler aus Delft brachte sich die Kunst des Mikroskopbaus
selbst bei und avancierte mit seinen neuen Erkenntnissen zum „Vater
der Mikroskopie“.
Die Alchemie vereint naturwissenschaftliche und philosophische
Aspekte. Vorrangiges Ziel seriöser Alchimisten ist es, mit
Hilfe chemischer Verfahren das Unreine vom Reinen zu trennen.
Immer bestimmender wird jedoch der Versuch aus unedlen Metallen
Gold herzustellen. Ausschlaggebend dafür ist das gewachsene, der Repräsentationspflicht
geschuldete Prunkbedürfnis der Herrscher, dem allerdings
notorische Geldknappheit gegenübersteht. Viele Betrüger
tummeln sich hier, was die Alchemie vermehrt mit Okkultismus,
Hexerei und Aberglauben in Verbindung und in Verruf bringt.

Maria Sibylla Merian, Metamorhosis insectorum Surinamensium.
Amsterdam, 1705. Kupferstich auf Papier, handkoloriert.
Georg-August-Universität, Niedersächsische Staats-
und
Universitätsbibliothek Göttingen. ©
SUB Göttingen, GR 2 Zool VI, 3904
Der Barockmensch nimmt die Welt zunehmend in Besitz und beginnt
sie zu erforschen und in Kunst und Wissenschaft abzubilden. Mineralogische
und botanische Interessen locken in ferne Regionen, die Reisenden
lernen eine fremdartige Flora und Fauna kennen. Diese wird mit
gebührender Genauigkeit betrachtet und anschließend
akribisch in reich bebilderten Folianten dargestellt. Die Kupferstecherin
und Naturforscherin Maria Sibylla Merian (1647-1717) widmet sich
auf ihren Reisen beispielsweise erstmalig der Insekten- und Pflanzenwelt
Surinams und hält ihre Beobachtungen in kunstvollen Kompositionen
fest. Auf Merians Arbeiten direkten Bezug nimmt die zeitgenössische
niederländische Künstlerin Joos van de Plas, die sich
in ihrem Werk mit der Metamorphose des Schmetterlings auseinandersetzt.
Die barocken Wunder- oder Kunstkammern an zahlreichen Fürstenhöfen
befriedigen Repräsentationslust und naturwissenschaftliche
Neugier zugleich. Sie sind Zentren des Wissens in Europa. Weltliche
und geistliche Fürsten, wissenschaftliche Gesellschaften
und vereinzelt auch Kaufleute wetteifern um den Besitz jener
fremdartigen Kunstwerke und staunenswerten Naturschätze,
die aus den neu entdeckten Weltgegenden nach Europa gelangen.
Aber nicht nur ferne Länder stehen im Fokus der Sammelleidenschaft,
sondern auch vergangene Epochen.
Besonders die Antike erfreut sich großer Beliebtheit.
Münzen und Statuen werden gesammelt und zur Quelle der Geschichtsforschung,
antike Bauwerke auf Reisen besichtigt.
„Ordnung“
Eine feste Ordnung strukturiert sämtliche Lebenswelten in
der Barockzeit: die Ständehierarchie, den Staat, die Gesellschaft.
Jeder hat seine vorbestimmte Rolle innerhalb der Gesamtstruktur
zu erfüllen. Über allen steht der Fürst und jedem
Untertan ist eine feste Position in der Hierarchie zugewiesen.
Der fürstliche Machtanspruch gipfelt im Herrschaftssystem
des Absolutismus. Im Hofzeremoniell wird die fürstliche
Macht für alle demonstriert. Um ihre Position zu sichern
oder ihr Herrschaftsgebiet zu vergrößern, führen
die Könige im Barock zahlreiche Kriege. An einer Mitmachstation
probieren die Besucher am eigenen Leib die strikte Kleiderordnung
des Barock aus. Diese legt genau fest, welche Kleidung und Accessoires
von welchem Stand getragen werden dürfen. Um den strengen
Regeln zu entkommen, schlüpfen Adelige bei Kostümfesten
in die Rolle von Schäfern, Bauern oder Wirtsleuten. Auch
Malerei, Literatur und Theater entführen in freiere Welten.
Das Prinzip der Ordnung spielt bei der Anlage von Städten
und Gärten eine große Rolle. Grafiken in der Ausstellung
zeigen, wie Mannheim oder Karlsruhe geplant und angelegt wurden.
Idealstädte sollen ein wohlgeordnetes Kunstwerk sein, das
durch Regelmäßigkeit und Geschlossenheit besticht.
Im Machtzentrum steht die Residenz, nach der sich der hierarchisch
gegliederte Stadtplan ausrichtet. Im Barock werden auch Gärten
und Parkanlagen zu Kunstwerken. Der Gartenarchitekt André Le
Nôtre (1613-1700) setzt mit seinen Ideen für die Schlossanlagen
von Vaux-le-Vicomte und Versailles neue Maßstäbe.
Viele der weltlichen und geistlichen Herrscher lassen sich Gärten
nach französischem Vorbild anlegen und schaffen sich ihr
eigenes kleines Versailles.

Vue et perspective du Jardin de Madame La Dauphine a
Versailles. Pierre Aveline, Paris, 1689.
Kupferstich auf Papier.
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. © rem, Foto: Maria Schumann
Gestaltet mit den Elementen der Natur
entsteht ein vermeintlich grenzenloser, künstlicher Kosmos,
in dessen weitläufigen Flächen jedes Element einer
strengen räumlichen Ordnung unterliegt. Wichtige Merkmale
sind symmetrisch angelegte Sichtachsen und geometrische Formen.
Der barocke Garten ist Ausdruck für die Beherrschung der
Natur und Machtsymbol zugleich. Den barocken Formenschatz greift
auch der zeitgenössische Künstler Luc Merx in seinen
Lampen auf. „Glauben“
Die Glaubensspaltung prägt Europa im 17. und 18. Jahrhundert.
Die Konfessionen werden erbitterte Gegner, nur an wenigen Orten
ist ein friedliches Nebeneinander über längere Zeit
hinweg möglich. Protestanten und Katholiken bekämpfen
sich mit Waffengewalt in den Glaubenskriegen, durch Wortgewalt
in Predigten und auch durch Bildpropaganda auf Gemälden
und Flugblättern. „Glaubensflüchtlinge“,
die wegen ihres Bekenntnisses ihre Heimat verlassen müssen,
sind allgegenwärtig. Einen besonderen Weg schlägt Kurfürst
Karl Ludwig beim Wiederaufbau Mannheims nach der Zerstörung
im Dreißigjährigen Krieg ein. Er rief in deutscher,
französischer und niederländischer Sprache „alle
ehrlichen Leute von allen Nationen“ dazu auf, sich in Mannheim
niederzulassen und gestand unter anderem Religionsfreiheit zu.

Büßende Maria Magdalena. Orazio Lomi Gentileschi,
um 1626/1628.Öl auf Leinwand.
Kunsthistorisches Museum Wien. ©
KHM–Museumsverband Wien
Die Konfessionen finden neue Ausdrucksformen. Neue katholische
Orden propagieren neue Heilige als Antwort auf protestantische
Glaubensinhalte und zur Bindung der Gläubigen. Die Heiligenverehrung
erfährt im Barock einen besonderen Höhepunkt. Für
alle Lebenssituationen und Nöte des Alltags stehen diese
den Gläubigen als Fürbitter zur Verfügung. Anhand
einer Reliquie stellt die Präsentation beispielsweise den
Nepomuk-Kult vor, der während der Gegenreformation vor allem
in den Ländern der Habsburger populär wird.
Malerei, Architektur und Musik werden zu Propagandazwecken eingesetzt.
Die Künstler versuchen, den Gläubigen emotional zu
packen, indem sie die Verehrung von Heiligen und den Marienkult
prunkvoll umsetzen. Protestantische Glaubensbilder rücken
hingegen das Wort Gottes und die Erlangung der Gnade Gottes ins
Zentrum. Ihre Darstellungsformen sind meist eher bescheiden und
nüchtern. Allerdings besteht der Dualismus vom schlichten
wortorientierten Protestantismus und dem prächtigen gegenreformatorischen
Katholizismus nicht immer.
Kriege und Seuchen einerseits sowie neue Erkenntnisse und Errungenschaften
in Wissenschaft und Technik andererseits wecken Zweifel an den
kirchlichen Glaubenssätzen. Die Reformation führt zu
einer der schwersten Krisen des Papsttums. Der Mensch des Barock
fühlt sich mit seinen Sorgen und Ängsten zunehmend
alleingelassen und zieht sich in individuelle Frömmigkeit
zurück. Hilfestellung bei der persönlichen Andacht
bieten die Bibel oder auch Bilder aus dem Leben der Heiligen.
Im Bereich „Glauben“ stehen sich in der Ausstellung
die Werke von zwei der berühmtesten Barockmaler gegenüber.
Eine Darstellung des Apostel Paulus von Rembrandt (1606-1669),
eine Leihgabe aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, und das
Bildnis einer lesenden Frau von Rubens (1577-1640) aus den Beständen
der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.

Bildnis einer lesenden Frau. Peter Paul Rubens / Jan Boeckhorst,
1. Hälfte 17. Jahrhundert.Öl auf mehrteiliger Eichenholztafel.
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. © rem, Foto: Jean Christen

Apostel Paulus. Rembrandt Harmensz van Rijn, 1633(?).Öl
auf Leinwand.
Kunsthistorisches Museum Wien. ©
KHM–Museumsverband Wien
„Zeit“
Gewaltige Kriege prägen das Leben der Menschen in der Barockzeit.
Neuigkeiten und Propaganda verbreiten sich dank Medien wie der
neu entwickelten Zeitung oder Flugblättern schneller als
je zuvor. In der Ausstellung ist mit der „Relation“ aus
dem Jahr 1609 die älteste erhaltene Zeitung der Welt zu
sehen.
Der Dreißigjährige Krieg, die sogenannten Reunionskriege
Ludwig XIV. und der Spanische Erbfolgekrieg erschüttern
das barocke Zeitalter und hinterlassen verwüstete Landstriche.
 Künstler zeigen in ihren Werken das Kriegsgeschehen in
all seiner Grausamkeit. Die Verheerungen wirken lange nach, denn
sie vernichten einen Großteil der Bevölkerung nicht
nur in den unmittelbar betroffenen Gebieten. Seuchen tun ihr Übriges.
Der Tod droht zu jeder Zeit und an jedem Ort. Künstler zeigen in ihren Werken das Kriegsgeschehen in
all seiner Grausamkeit. Die Verheerungen wirken lange nach, denn
sie vernichten einen Großteil der Bevölkerung nicht
nur in den unmittelbar betroffenen Gebieten. Seuchen tun ihr Übriges.
Der Tod droht zu jeder Zeit und an jedem Ort.
Pendule. Louis oder Jean Amant, Paris, um 1750-60. Messing,
Glas, Email, Gold. Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. © rem,
Foto: Lina Kaluza
Angesichts von Pest, Kriegen und Katastrophen ist der barocke
Mensch von einem tief verwurzelten Todesbewusstsein geprägt.
Vanitas-Stillleben und Memento Mori-Darstellungen sind verbreitet.
Auf Bildern gemahnen prachtvolle, aber nur kurz blühende
Blumen an die Vergänglichkeit von Schönheit und Jugend
und an das schnelle Vergehen alles Irdischen.
Totenschädel, erlöschende Kerzen und rieselnde Sanduhren
sind eindrückliche Zeichen für das Verrinnen der Lebenszeit
und sehr beliebte Motive in Memento Mori-Bildern. Neben historischen
Vanitas-Darstellungen schlägt eine Barock-Punk-Performance
des zeitgenössischen Künstlers Ludger Engels die Brücke
in unsere Zeit. Das Stück „Semele Walk“ zur
Musik von Georg Friedrich Händel besticht durch auffällige
und exzentrische Kostüme der berühmten Designerin Vivienne
Westwood. Semeles Kleid ist aus ungewöhnlichem, mehrlagigem
Chiffon, der auf der einen Seite mit Goldbronze beschichtet und
auf der anderen Seite mit üppigen Blumenornamenten bedruckt
ist. Semeles Ende im Feuer wird bei jeder Bewegung durch das
unterschiedlich aufscheinende Material vorweggenommen.
Den Menschen im Barock ist jedoch nicht nur die Vergänglichkeit
der Zeit bewusst, die Zeit wird auch mit neuen Geräten gemessen.
Die geistlichen Lebenswelten, das absolutistische Hofzeremoniell
und das bürgerliche Organisationsbedürfnis benötigten
eine feste Struktur: Tages-, Jahres- und Lebensablauf werden
streng geregelt. Prunkuhren für den Adel, öffentlich
sichtbare Uhren und Uhren im bürgerlichen privaten Bereich
strukturieren den Tag und ermöglichten Planung und Verabredungen.
Die Geräte sind nicht nur funktional, sondern repräsentierten
auch den sozialen Status ihrer Besitzer. So wie Uhren den Tag,
teilen Kalender das Jahr ein. Sie halten religiöse und weltliche
Feste, Geburts- und Todestage und Tage für Aussaat, Ernte
und Aderlass fest.
Dass Zeit aber auch Anschauungs- bzw. Glaubenssache sein kann,
beweist die Nutzung zweier unterschiedlicher Kalender. Während
die Protestanten den Julianischen Kalender beibehalten, nutzen
die Katholiken den 1582 eingeführten Gregorianischen Kalender.
Die Differenz der beiden Kalender beträgt mehrere Tage.
|