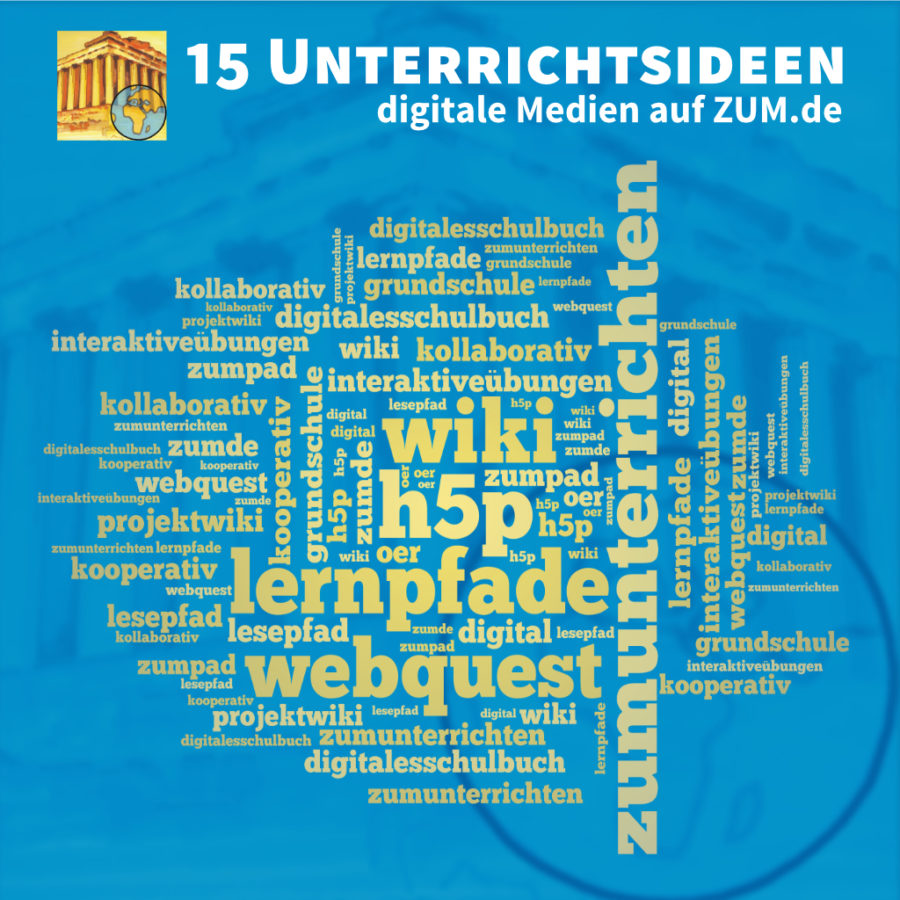Die Möglichkeiten zum digitalen Arbeiten mit der ZUM sind sehr vielfältig. Bisher sind in dieser Reihe folgende Beiträge erschienen:
- einem Lernpfad folgen
- kollaborativ Texte erstellen
- den Boden erforschen
- Irland mit einer Webquest kennen lernen
- interaktive Übungen im Unterricht einsetzen
- interaktive Übungen erstellen
- eine Unterrichtsreihe mit einem Wiki begleiten
Dies ist der erste Beitrag zu Grundschulthemen. Die nächsten beiden Artikel richten sich ebenfalls an Kolleg*innen der Primarstufe.
Ein WebQuest ist eine spezielle Form der Internetrecherche. Wichtig dabei ist:
- die Schüler arbeiten in Teams,
- der Lehrer/die Lehrerin entlastet durch Vor-Recherchen (Auswahlliste von Links) die Sucharbeit und grenzt dadurch die Suchergebnisse in gewissem Umfang ein,
- die Ergebnisse werden präsentiert,
- die Arbeitsprozedur wird gemeinsam reflektiert.
Was sind WebQuests?
Die WebQuest-Methode ist von Bernier Dodge an einer amerikanischen Universität in der Mitte der 1990er Jahre entwickelt worden. Dodge beschreibt das WebQuest als eine entdeckungsorientierte Aktivität.[Moser, Heinz (2001): WebQuests im Geschichtsunterricht, S. 26.] Der Begriff WebQuest setzt sich aus den zwei englischen Wörtern „web“ und „quest“ zusammen. Die Begrifflichkeit „quest“ bedeutet abenteuerliche Spurensuche [Gerber, Sonja (2007): WebQuests – E-Learning nicht nur für Anfänger, S.2.] , sodass die Begrifflichkeit „WebQuest“ als „Abenteuerliche Spurensuche im Internet“ verstanden werden kann. Besonders die Begrifflichkeit „Quest“ erinnert sehr an Computerspiele, bei denen Missionen („Quests“) erfüllt werden müssen. Er entwickelte diese Methode, weil er nach Möglichkeiten suchte, das Internet und damit verbunden die Fülle an Wissen im Unterricht sinnvoll einzusetzen. In seinem Aufsatz „Some Thoughts about WebQuests“ [Dodge, Bernier (1995): Some Thoughts About WebQuests, http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html] beschreibt Dodge seine didaktischen Überlegungen. Er definiert das WebQuest als „an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources on the internet“ [Dodge, Bernier (1995): Some Thoughts About WebQuests, http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html] (Dt.: eine nachforschend-orientierte Aktivität, in welche einige oder alle Informationen, mit denen die Lernenden interagieren, aus dem Internet kommen).
Im deutschsprachigen Forschungsraum wird der Begriff WebQuest weitergefasst. Sonja Gerber definiert das WebQuest als ein Lehr- und Lernarrangement, bei dem sich die Lernenden im Internet bewegen und sich das Wissen aktiv aneignen. [Gerber, Sonja (2007): WebQuests – E-Learning nicht nur für Anfänger, S.2.] Der Schwerpunkt dieser Methode liegt dabei auf der Informationsnutzung und nicht auf der Informationssuche. [Gerber, Sonja (2003): WebQuest – ein Konzept für sinnvollen Computer- und Interneteinsatz an Schulen, S. 9.] Aus diesem Grund werden den Schülerinnen und Schülern Informationen zur Verfügung gestellt, die aus dem Web stammen. [Dodge, Bernier (1995): Some Thoughts About WebQuests,http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html] Die Internetquellen dienen als Ausgangspunkt für die Bearbeitung einer Problemstellung. Allerdings soll das Internet nicht die einzige Quelle für die Schülerinnen und Schüler sein. Vielmehr sollen durch die Lehrperson auch weitere Ressourcen und Quellen in den Unterricht eingebracht werden. Darin unterscheiden sich vor allem die Überlegungen von Dodge und den deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Aufbau von WebQuests
- Ein WebQuest beginnt mit der Einführung zum Thema, also der Startseite, die der Benutzer des WebQuests normalerweise zuerst sieht. Dabei ist es entscheidend, dass die Einführung ins Thema eine Fragestellung, ein Problem oder ein Rätsel aufwirft, welches die Nutzer des WebQuests motiviert, dieses zu lösen. [Moser, Heinz (2008): Abenteuer Internet, S. 32.] Aus der Einleitung sollte sich die „Meta-Aufgabe“ ergeben, die mit Hilfe der Bearbeitung der Unteraufgaben im WebQuest gelöst wird. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt dann in der Präsentationsphase.
- Anschließend werden zu dem Thema konkrete Aufgaben im Bereich „Aufgabenstellung“ formuliert. Die Aufgaben sind dafür da, um die oben genannte „Meta-Aufgabe“ zu bearbeiten und dienen meist dazu, Informationen zu sammeln und zu recherchieren. Die Ergebnisse sollen dabei in schriftlicher Form, in einer künstlerischen Auseinandersetzung oder ähnlichem gesichert werden. [Moser, Heinz (2008): Abenteuer Internet, S. 34.] Es geht also im zweiten Teil darum, „[…] die Zielsetzung des WebQuest in konkrete Aufgaben- und Fragestellungen zu übersetzen.“ [Moser, Heinz (2008): Abenteuer Internet, S. 34.]
- Als Drittes müssen die Quellen zur Bearbeitung der Aufgaben „online“ bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich normalerweise um Links; die online im Web zu finden sind, aber evtl. auch um Quellen oder Materialien, die analog gesammelt worden sind.
- Im vierten Teil wird die Art und Weise des Lernprozesses festgehalten. In diesem Teil ergeben sich Möglichkeiten, wie das WebQuest bearbeitet werden kann. Grundlegend soll der Lernprozess auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden, die das WebQuest bearbeiten, allerdings werden in diesem Teil Empfehlungen über die Sozialform oder Arbeitsschritte für die Bearbeitung des WebQuests gegeben. Es soll aber auch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eingeräumt werden, selbst zu entscheiden, wie die einzelnen Arbeitsaufträge bearbeitet werden. Dies soll im Vorfeld mit der Lehrkraft besprochen werden, wobei die Lehrkraft hier besonders auf die Bedürfnisse der Lernenden reagiert.
- Im fünften Teil werden Möglichkeiten zur Evaluation vorgestellt. Moser empfiehlt, dass nach der Bearbeitung des WebQuests dieser evaluiert wird, um beurteilen zu können, ob die Ziele erreicht wurden. Er schreibt: „[…] eine Selbstevaluation, welche den eigenen Arbeitsprozess reflektiert, [gehört] zu einem WebQuest. Ziel ist es dabei, die Qualität der Arbeit zu bewerten und aus den Arbeitserfahrungen zu lernen.“ [Moser, Heinz (2008): Abenteuer Internet, S. 38.]
- Im letzten Teil werden die Ergebnisse der Meta-Aufgabe publiziert und der Netz-Öffentlichkeit zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt. Das „knowledge sharing“ gilt als ein Grundprinzip des WebQuests, d.h. die entstandenen „Produkte“ sollen andere Schülerinnen und Schüler nutzen, um selbst motiviert und neugierig auf die Bearbeitung des WebQuests zu werden. Dabei unterscheidet sich vor allem dieser Bereich von der amerikanischen WebQuest-Forschung. Hier werden nur Arbeitspläne und das Vorgehen von Seiten der Lehrperson publiziert, dagegen sollen nach Moser im deutschen Forschungsraum die Ergebnisse der Lernenden mehr im Vordergrund stehen. [Moser, Heinz (2008): Abenteuer Internet, S. 41.]
Wo finde ich WebQuests für die Grundschule und wie setze ich sie ein?
Durch die Gliederung in klare Teilschritte werden klar definierte Vorgehensweisen beschrieben, dabei sollte jedoch genug Freiraum für Kreativität gelassen werden. Des Weiteren finden arbeitsmethodische Hinweise, wie der Zeitrahmen und die Gruppenaufteilung hier ihren Platz. Ein WebQuest soll das prozessorientierte Lernen unterstützen.
Es werden konkrete Angaben mit nicht zu viel Ablenkungsmaterial zur Verfügung gestellt. In der Regel sind dies Links zu externen Web-Seiten, es können aber auch andere Materialien aus Büchern, Filmen, Podcast etc. zur Anwendung kommen.
Außerdem sollten diese altersgerecht sein, damit die Aufgaben von jedem Schüler bewältigt werden können. Das Ziel hier lautet also: Nutzen, nicht Suchen von Informationen!
 Prof. Dr. Christof Schreiber hat die PrimarWebQuests für die Grundschule angepasst. Dabei war es erforderlich, die Methode für die Zielgruppe zu adaptieren. Es wird auf verschiedene Rollen verzichtet und die Kinder als „Forscher“ angesprochen. Außerdem wurde die Unterscheidung von Aufgabe und Vorgehen aufgehoben und in einer Projektbeschreiung zusammen gefasst. Eine Reihe weiterer Vereinfachungen sind: Verzicht auf Tabellen zur Bewertung, es wird kein Fazit gefordert, sondern lediglich ein Ausblick gegeben, die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen ist nicht öffentlich, sondern im Klassenverband.
Prof. Dr. Christof Schreiber hat die PrimarWebQuests für die Grundschule angepasst. Dabei war es erforderlich, die Methode für die Zielgruppe zu adaptieren. Es wird auf verschiedene Rollen verzichtet und die Kinder als „Forscher“ angesprochen. Außerdem wurde die Unterscheidung von Aufgabe und Vorgehen aufgehoben und in einer Projektbeschreiung zusammen gefasst. Eine Reihe weiterer Vereinfachungen sind: Verzicht auf Tabellen zur Bewertung, es wird kein Fazit gefordert, sondern lediglich ein Ausblick gegeben, die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen ist nicht öffentlich, sondern im Klassenverband.
Was aber bleibt, ist der hohe Vorbereitungsaufwand für WebQuests, der durch den/die Fachlehrer*in zu leisten ist. Daher entwickelte Prof. Dr. Christof Schreiber, der die Professur Mathematikdidaktik mit Schwerpunkt Grundschule in an der Justus-Liebig-Universität in Gießen inne hat, bereits vor einigen Jahren die ZUM-WebQuest-Seite. Es werden einerseits eine Reihe WebQuests bereits zur Verfügung gestellt, andererseits beinhaltet die Seite einen WebQuest-Generator, der die Lehrkraft recht einfach durch die Erstellung einer WebQuest leitet. Die dabei entstandenen Quests stehen den Kolleg*innen wiederum zur Verfügung.
Das Projekt wurde seinerzeit im Rahmen der vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend getragenen Initiative „Ein Netz für Kinder“ gefördert.