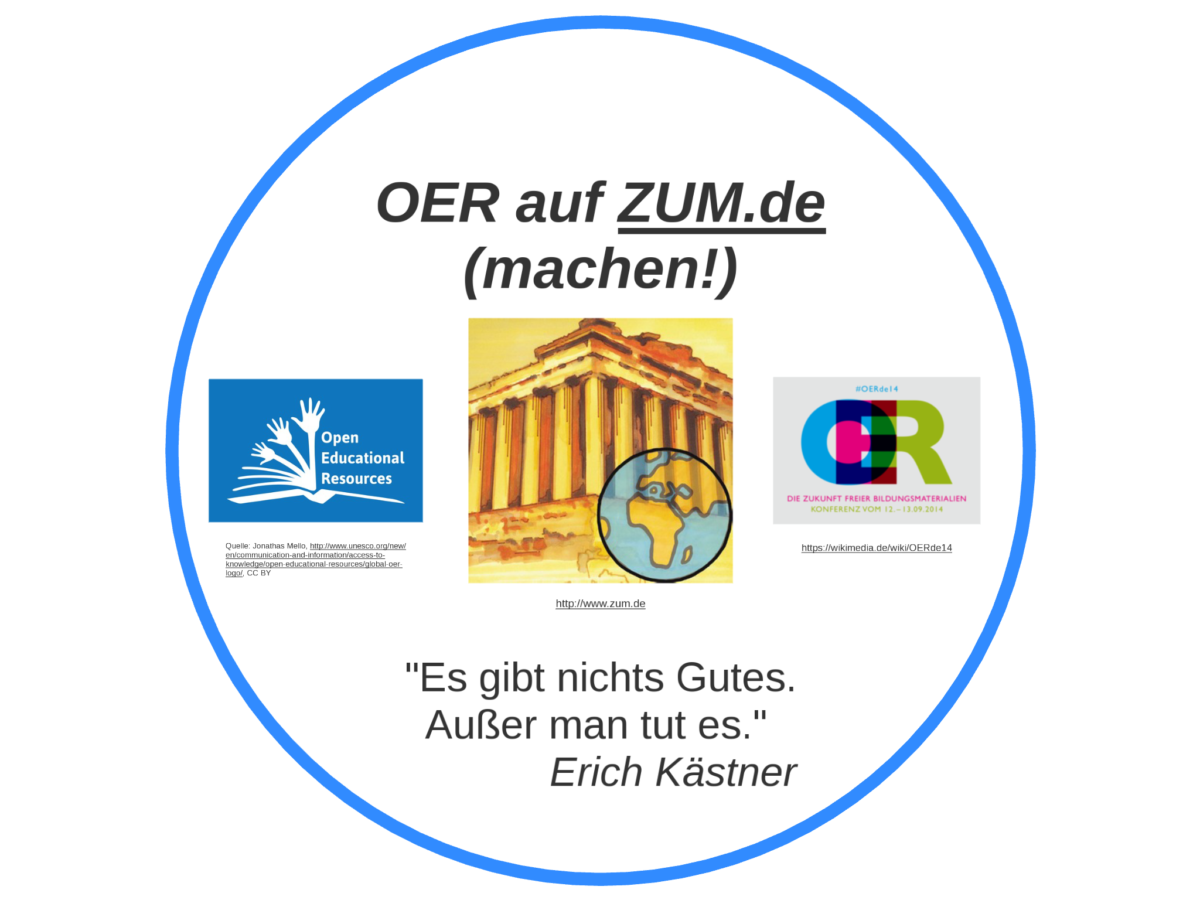Am 12. und 13. September habe ich auf der der OER-Konferenz 2014 in Berlin teilgenommen und dort einen Beitrag unter dem Titel „OER auf ZUM.de – Wie viele tun, wovon andere reden“ gehalten und eine Session mit dem Titel „ZUM.de in der Praxis“ im Rahmen des OER Camps 2014 durchgeführt.
Einige Vorträge aus dem reichhaltigen Programm konnte ich selbst besuchen:
- René Pickhardt stellte in „Einfaches Erstellen von MOOCs auf Wikiversity – So erstellst du einen modernen MOOC unter offener Lizenz auf Wikiversity“ Erweiterungen der MediaWiki-Software vor, die im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt, an dem er mitarbeitet, entstanden sind. Für mich war dies faszinierend, weil es zeigt, dass in der Arbeit mit der MediaWiki-Software weitaus mehr Potenzial steckt als das, was in den Wikimedia-Projekten genutzt wird. Auch für die Wikis auf ZUM.de ergeben sich daraus eventuell noch zusätzliche Möglichkeiten.
- Matthias Bock, Abgeordneter der Piraten-Partei in Nordrhein-Westfalen, präsentierte die „Einführung von OER in Schulen am Beispiel NRW – Ein Modell – Wer macht was und wer soll das bezahlen? Der Versuch einer klaren Antwort„. Dabei geht es im Kern um die Idee, dass das Geld, was die öffentliche Hand (Land und Kommunen) für Schulbücher ausgebe, durch die Einführung von OER-Materialien eingespart und insgesamt kostenneutral dafür ausgegeben werden könne, jedem Schüler und jeder Schülerin über die Schulen einen Tablet-Rechner zur schulischen und häuslichen Nutzung zur Verfügung zu stellen, und zwar gerechnet bei Stückkosten von 100 Euro und einer Nutzungslaufzeit von jeweils vier Jahren. – Dies wollte Matthias Bock ausdrücklich als Gegenmodell zu der von der Landesregierung bevorzugten Idee des „Bring Your Own Device“ (BYOD) verstehen.
Auch wenn ich die Intention, einerseits OER-Materialien zu fördern und andererseits den Zugang zu sinnvollen digitalen Endgeräten für alle, grundsätzlich gut finde, so habe ich doch zwei Vorbehalte:
1. Ich mag nicht glauben, dass die massive Verbreitung digitaler Endgeräte automatisch zu einem sinnvollen unterrrichtlichen Gebrauche führen wird. Sinnvoller wäre es, parallel Pilotprojete zu starten und pasende Konzepte hierfür zu entwickeln.
2. Meine eigene Erfahrung spricht dafür, dass BYOD durchaus ein sinnvoller Weg sein kann, da ja bereits heute wohl in nahezu allen Lerngruppen der Sekundarstufe I und II (spätestens ab dem 7. Jahrgang, wahrscheinlich aber schon früher) ausreichend internetfähige Smartphones täglich von den Schüler_innen mitgeführt werden. Sie brauchen nur – nach entsprechenden vorherigen Absprachen – aus der Tasche genommen und angeschaltet zu werden: Schon können sie ür Internetrecherchen, aber auch als Taschenrechner, Schreibgerät, Foto- oder Videokamera, als Aufnahmegerät für Podcasts ets. verwendet werden. - Die Initiatoren und „Macher“ des ersten freien OER-Schulbuchs, eines Biologie-Buchs für den 7. und 8. Jahrgang nach Berliner Lehrplan, dessen Realisierung wir von der ZUM durch einen Beitrag zum Crowdfunding für dieses Projekt und auf anderen Wegen unterstützt haben, bereichteten unter dem Titel „Schulbuch-O-Mat lessons learned – Dos und Don’ts in kollaborativen OER-Projekten“ von ihren Erfahrungen mit und Lehren aus diesem Projekt.
Für mich war dies eine willkommene Gelegenheit, Hans Hellfried Wedenig, den ich bisher nur von Mail- und Telefonkontakten kannte, und seinen Mitstreiter Heiko Przyhodnik einmal persönlich kennen zu lernen. – Ich freue mich sehr, dass die beiden ihr Projekt durchgezogen und damit bewiesen haben, dass ein freies Schulbuch möglich ist.
Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass der Erfolg dieses Projektes und die damit verbundenen öffentlichen Berichte und Diskussionen mit dazu beigetragen haben, dass jetzt auch zahlreiche Schulbuchverlage mit digitalen Schulbüchern, oft ergänzend zu den gedruckten Ausgaben, aber zum Teil auch als reine digitale Versionen, auf den Markt kommen. Dies sind zwar keine OER-Materialien, aber vielleicht doch eine Reaktion auf deren Erfolg. - Guido Brombach, Mitorganisator des kommenden EduCamps in Hattingen 2014, berichtete über „10 Tipps zur Veröffentlichung von OER Materialien in der politischen Bildung – Nachnutzung leicht gemacht„. Kurz gefasst geht es ihm dabei draum, zu betonen, dass es für den Erfolg von OER-Materialien nicht alleine auf einen einmal veröffentlichten Inhalt, sondern auch darum geht, diesen Inhalt zu verbreiten, mit anderen in Diskussionen zu kommen etc. – Das sind 10 Tipps, die wohl ganz allgemein beachtenswert sind, nicht nur in der politischen Bildung 😉
Wie der Sessionplan zeigt, gab es im Rahmen des OER-Camps auch sehr viel Beachtenswertes.
Für mich hat sich die OER-Konferenz 2014 auf jeden Fall wegen verschiedener konkreter Informationen sowie zahlreicher persönlicher Kontakte und Diskussionen gelohnt. Die Veranstaltung selbst war von der Wikimedia Deutschland e. V. sehr gut organisiert und wurde von Jöran Muuß-Merholz hervorragend und mit einer angenehmen Portion Humor moderiert.
Ich denke, dass solche Veranstaltungen dazu beitragen können, dass das Thema OER weiter an Beachtung und an Bedeutung gewinnt.
Gefestigt hat sich aber auch meine Überzeugung, dass es nicht genügt, über OER zu reden, es braucht auch Menschen, die OER-Materialien erstellen. Und ich bin der Überzeugung, dass dies von zahlreichen Autorinnen und Autoren auf ZUM.de vor allem deshalb so gut gelingt, weil sie vor allem an den Inhalten selbst und an deren Einsatz im Unterricht interessiert sind.