|
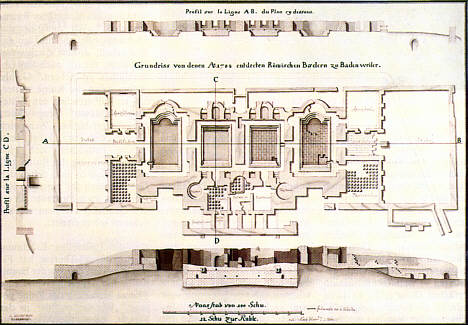
Plan der
Thermen bei ihrer Entdeckung im 18. Jahrhundert
Nachdem wohl
bereits die Kelten in vorrömischer Zeit die warmen Quellen
Badenweilers genutzt hatten, entstand bereits kurz nach der römischen
Eroberung des rechtsrheinischen Landes am Ende des 1. Jahrhundert
n. Chr. um die Quellen eine zivile Siedlung mit einem Badegebäude.
Diese nach
den bereits 1784 duchgeführten Ausgrabungen heute mit Ausnahme
der beiden äußeren Vorräume sichtbare Anlage
war nicht in einem Zug entstanden. Sie bestand zunächst
aus zwei nebeneinander gelegenen rechteckigen Becken, neben denen
jeweils ein Ankleideraum lag. Nach Norden, hangabwärts,
lag ein rechteckiger Anbau (im Bild unten). Ihre südliche,
hausaufwärts gelegene Hauptfassade war architektonisch reich
gegliedert. Konchen sprangen halbrund vor die Flucht der Fassade,
Nischen enthielten vermutlich Statuen.Dieser Bau war bereits
nach den strengen Regeln von Geometrie und Harmonie geplant und
gebaut.
Bemerkenswerterweise waren trotz einer heute festgestellten Quellwassertemperatur
von 26,5° die Badebecken nicht durch Hypokaustanlagen beheizt,
so dass sich die Frage nach der damaligen Wassertemperatur bzw.
den damaligen Badegewohnheiten stellt.
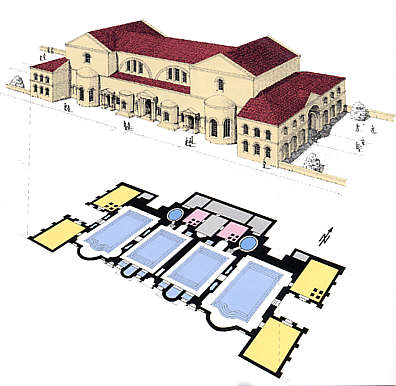 Rekonstruktion
der Thermen nach dem Wiederaufbau (2. Baustufe, Sicht von SO). Bild:
Landesdenkmalamt B-W, Außenstelle Freiburg Rekonstruktion
der Thermen nach dem Wiederaufbau (2. Baustufe, Sicht von SO). Bild:
Landesdenkmalamt B-W, Außenstelle Freiburg
In einer späteren
Bauphase wurden diese Ankleideräume zu zwei weiteren Badebecken
umgebaut. Die Apsiden der ehemaligen Umkleideräume wurden
als Badenischen der eigebauten Becken beibehalten und elaubten
wohl individuelle Anwendungen. Grund hierfür waren sowohl
die gestiegenen Ansprüche an den Badebetrieb als auch Schäden
am Bauwerk selbst. Den Schmalseiten des Baus wurden neue Empfangs-
und Auskleiderräume vorgelegt, durch die die Anlage fast
doppelt so lang wurde. Der Nordbau, ehemals Eingangsbereich,
wurde durch den Einbau von Schwitzräumen (Sudatorien) und
kreisrunden Becken (Piscinen) für Kaltwasser grundlegend
umgestaltet. Die Sudatorien waren ebenso wie die beiden nördlichen
Auskleideräume hypokaustbeheizt.Die ganze Anlage blieb auch
nach dem Umbau symmetrisch angelegt und durch eine starke Mittelmauer
in zwei gleiche Bereiche getrennt, die vermutlich als separate
Männer- und Frauenabteilungen genutzt wurden. Zu- und Ableitung
des Quellwassers waren durch im Untergrund angelegte gemauerte
Kanäle gelöst.

Holzmodell
des römischen Thermengebäudes im Maßstab 1:
66,6 nach den Untersuchungen von H. Mylius.
Bild: Landesdenkmalamt B-W, Außenstelle Freiburg
Eines der
Grundprinzipien der Architektur war, dass jeder Bauteil eine
eigene Dachkonstruktion hatte. Das hatte natürlich technische
Gründe, trug aber zu einer sehr hohen Vielfalt in der Gestaltung
der Dachlandschaft bei. |