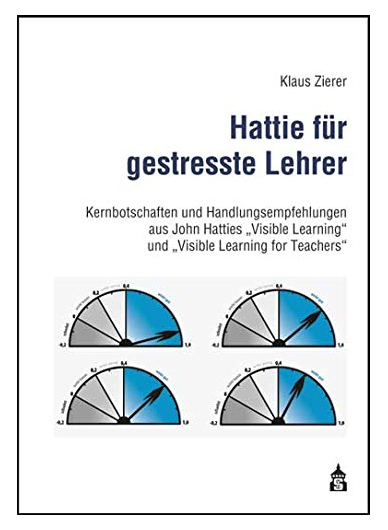2009 veröffentlichte der australische Bildungsforscher John Hattie die Ergebnisse seiner Studien. Seitdem gilt der Leiter des Instituts für Bildungsforschung an der Universität Melbourne als der einflussreichste Lernforscher der vergangenen Jahre, manche sagen auch „weltweit“ (S. 11). In 15-jähriger Arbeit hatte Hattie 800 Meta-Analysen ausgewertet – eine Meta-Analyse ist eine Zusammenstellung von Einzelstudien – ingesamt davon sollen 80 000 in die Studie eingegangen sein. Die Auswertungen und Ergebnisse wurden auf tausenden von Seiten veröffentlicht, die wesentlichen Titel lauten „Visible Learning“(„Lernen sichtbar machen“, 2013) und „Visible Learning for Teachers“ („Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen“, 2014).
Wer soll das lesen?
Diese Frage stellte sich auch Klaus Zierer, seinerseits Professor und Bildungsforscher an der Uni Augsburg und Verfasser des Buches „Hattie für gestresste Lehrer“ (Schneider Verlag 2015). Darin stellt er auf knapp 130 Seiten die „Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen“ (Untertitel) der Mammut-Studie zusammen. Zugleich wird deren Übertragbarkeit auf das deutsche Bildungssystem in den Blick genommen.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Arbeitsmethodik Hatties: Dieser erstellt eine Liste von „Faktoren“, die die schulischen Lernleistung fördern können und ermittelt mit einer komplexen Formel deren „Effektstärken“. An diesen ist dann ablesbar, ob der betreffende Faktor die Lernleistung fördert oder auch nicht. Am Ende des Buches ist die Auflistung der 150 Faktoren und ihrer Effektstärken abgedruckt (S. 126 ff): Auf Platz 1 steht der Faktor „Selbsteinschätzung des eigenen Lernniveaus“ und auf dem letzten Platz der „Schulwechsel“ mit einer negativen Effektstärke.
In den weiteren Kapiteln widmet sich der Autor den (im Positiven und Negativen) relevantesten Faktoren und immer wieder wird der eine Kernsatz bestätigt: „Auf die Lehrperson kommt es an“. Von ihr hängt ab, ob etwas wirkt! Schulstrukturen, die Reduzierung der Klassengröße, die Investition in neue Medien, die instruktiven und/oder offenen Unterrichtsformen, die fachliche Kompetenz – sie alle zeigen erst dann Wirkung („visibility“), wenn die Lehrperson damit klug umzugehen weiß.
Zwei Zitate können diesen Zusammenhang verdeutlichen:
1. „In den Untersuchungen wurde festgestellt, dass allein die Reduzierung der Klassengröße nur einen geringen Unterschied ausmacht, weil Lehrpersonen durch diese Maßnahmen ihr Handeln nicht automatisch ändern. Sie nutzen beispielsweise die kleinere Schülerzahl nicht von selbst, um besseres Feedback zu geben, um mehr Gespräche mit den Lernenden zu suchen, um die Lernenden stärker in den Unterrichtsprozess miteinzubeziehen.“ (S. 37)
2. Neue Medien „erreichen eine geringe Effektstärke … , die noch dazu ziemlich konstant über die letzten 20, 30 Jahre ist … Der Grund ist einfach: Lehrpersonen nutzen neue Medien häufig nur als Ersatz für traditionelle Medien: das Whiteboard als Tafel, das Internet als Lexikon, das Tablet als Arbeitsblatt usw. Allein das Anschaffen neuer Medien für das Klassenzimmer reicht nicht aus. Die Kompetenz der Lehrpersonen, diese zu nutzen, ist viel wichtiger.“ (S. 71)
Was also wirkt wirklich? Als entscheidend werden genannt
- häufiges und qualifiziertes Feedback, das zu einer realistischen Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus beiträgt (S. 47 f, S. 64ff)
- „Direkte Instruktion“ unter der Voraussetzung von „Klarheit im Hinblick auf Ziele, Inhalte, Methoden, Medien, Raum und Zeit sowohl auf Seiten der Lehrpersonen als auch auf Seiten der Lernenden“ (S. 62)
- Kooperative Lernformen, wenn „die Schülerinnen und Schüler in Phasen des kooperativen Lernens wissen, worum es geht, was zu tun ist, womit gearbeitet werden soll.“ (S.63 f)
- „Bewusstes Üben“, das herausfordernd, vielfältig und regelmäßig ist. Indem die Lehrperson dies ermöglicht, ergeben sich daraus wieder „eine Reihe von Rückmeldungen … von den Lernenden, was diese verstanden haben und was nicht …“ (S. 69)
Das Buch kann tatsächlich Stress abnehmen:
1. durch die Fokussierung auf das Wesentliche: den Unterricht, die Lehrer-Schüler-Beziehung, die Rollenklarheit. Insbesondere uns deutsche Lehrerinnen und Lehrer, die oft genug ein schlechtes Gewissen plagt (Stichwort: OECD und PISA) von wegen zu viel „Frontalunterricht“ und zu lehrerzentriert und mit zu wenig Medieneinsatz usw., – uns kann es entlasten zu lesen, dass „direkte Instruktion“ hoch effizient sein kann und dennoch mit dem Frontalunterricht von gestern nicht verwechselt werden darf. (S.61f)
(Eine Empfehlung hierzu: Herbert Gudjons „Frontalunterricht – neu entdeckt. Integration in offene Unterrichtsformen“, Klinkhardt 2003)
2. Es kann auch entlasten zu erfahren, dass in bestimmten Bereichen die Lehrpersonen „nicht verantwortlich gemacht werden können“ (S. 42): das sind die Elternhäuser, deren sozioökonomischer Status oder das Medienverhalten der Kinder. Hier wirkt der Matthäus-Effekt: Wo viel ist, kommt viel dazu. Wo nichts ist, wird auch nichts – oder nur unter großen Anstrengungen. Kinder aus bildungsfernen Milieus müssen mehr leisten, um ein „Übertrittszeugnis auf das Gymnasium zu erhalten“ (45). Hier wird eine intensive Kooperation mit den Eltern empfohlen.
3. Und schließlich ist noch die übersichtliche Darstellung zu erwähnen: Hauptausagen und Kernbotschaften werden nach jedem Kapitel noch einmal in (grauen) Kästen zusammengefasst, es gibt sogar „Reflexionsaufgaben“ und am Schluss zehn „Handlungsempfehlungen für die Praxis“ (S. 107-125).
***
 Zusammen mit John Hattie hat es Klaus Zierer dann 2020 unternommen, die Vorschläge zu „evidenzbasiertem” Unterricht methodisch-didaktisch zu konkretisieren: „Visible Learning – Unterrichtsplanung” lautet der Titel (Schneider Verlag 2020, 330 Seiten) und dies ist die Kernbotschaft:
Zusammen mit John Hattie hat es Klaus Zierer dann 2020 unternommen, die Vorschläge zu „evidenzbasiertem” Unterricht methodisch-didaktisch zu konkretisieren: „Visible Learning – Unterrichtsplanung” lautet der Titel (Schneider Verlag 2020, 330 Seiten) und dies ist die Kernbotschaft:
Eine erfolgreiche Lehrperson agiert in erster Linie wie ein Regisseur – nicht wie ein Moderator (S.18). Ein Regisseur überlässt nichts dem Zufall, hat die Ziele der Unterrichtstunde immer vor Augen, überprüft ausgewählte Methoden, kennt die Voraussetzungen der Akteure und ist sich seiner Wirkung bewusst („Kenne Deinen Einfluss!”). Und er hat ein Planungsmodell mit „Nähe zum Instruktionsdesign“ (S. 23).
Wie gehen die Autoren vor?
Exemplarisch werden alle relevanten Diagnose- und Planungsprozesse anhand einer einzigen Unterrichtsstunde dargestellt: Eine 3. Klasse mittlerer Größe, heterogen zusammengesetzt, in einer durchschnittlich ausgestatteten Grundschule. Das Unterrichtsthema lautet schlicht „Licht“ und ist dem Sachunterricht zuzuordnen.
Auf 250 Seiten wird diese Stunde nun unter den vier übergeordneten Kategorien geplant (siehe: Inhaltsverzeichnis)
- Diagnosis : Analyse der Lernenden, der situativen Rahmenbedingungen, des Unterrichtsinhaltes der eigenen Lehrerprofessionalität erläutert.
- Intervention: Planung von Zielen, Inhalten, Methoden, Medien, Raum und Zeit.
- Implementation: Durchführung der Stunde
- Evaluation: Auswertung der Stunde
Das klingt zunächst vielversprechend und entspricht in etwa der Vorgehensweise, wie sie in Universitäten und Lehrer:innen-Seminaren üblich ist. Da aber diese Stunde nie gehalten wurde, steht sie als reales Unterrichtsereignis nicht zur Analyse bereit. Vielmehr ist sie Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für die Anwendung jener oben erwähnten Faktoren-Liste und ihrer Effektstärken auf die einzelnen Aspekte eines möglichen Unterrichtsgeschehens.
Daran anknüpfend werden dann für jede Phase des Unterrichsprozesses Vorschläge gemacht mit Niveauabstufungen, Erfolgskriterien, Materialien, Versuchsanordnungen und mehr.
Alles zusammen bildet eine umfangreiche Gesamtschau und Bewertung von didaktischen Modellen, in der jedoch merkwürdigerweise der Begriff „Kompetenz”, wie er in den letzten 15 Jahren die didaktische Diskussion geprägt hat, nicht vorkommt. Statt dessen wird die Bloom’sche Lernziel-Taxonomie (vgl. S. 126) herangezogen.
Für die typografische Gestaltung der Praxis-bezogenen Teile haben sich die Verantwortlichen für die Farbe dunkelblau auf hellblauem Hintergrund entschieden, manchmal auch für schwarze Schrift auf dunkelblauem Hintergrund, so dass ausgerechnet die Konkretisierungen und Praxisvorschläge am schwersten lesbar und am wenigsten motivierend sind (siehe z.B. S. 226ff).
Da dies – wie schon erwähnt – sich über 250 Seiten erstreckt, unter intensiver Bezugnahme auf Faktoren, Faktoren-Bündel und Effektstärken, auf Dimensionen, Domainen und Diagramme, kann der interessierte Leser durchaus eine Vorstellung dessen bekommen, was unter „Evidenzbasierung“ zu verstehen ist, und von der Wissenschaftlichkeit der empirischen Unterrichtsforschung beeindruckt sein. Es kann ihm aber auch Hören und Sehen vergehen, weil er/sie sich Unterricht und Schule ganz anders vorstellt und erlebt: Weniger als aufwändig durchgestylte Abfolge von Mikroprozessen, sondern als umfassende erzieherische Aufgabe, in der die Einzelstunde nur ein Teil und zuweilen auch nicht der wichtigste ist.
Wem ist folglich dieses Buch zu empfehlen?
Aufgrund seiner Detailversessenheit, Kategorienvielfalt und unglücklicher Gestaltung in erster Linie denjenigen, die an unterrichtsmethodischen und didaktischen Tiefenstrukturen und Prozessen interessiert sind bzw. sein müssen: also denjenigen, die mit der Ausbildung von Lehrkräften an der Universität, den Pädagogischen Hochschulen und den Lehrer-Seminaren beschäftigt sind.
Des Weiteren denjenigen, die sich auf ein didaktisches Prüfungskolloquium vorbereiten und den Themenschwerpunkt Hattie gewählt haben.
Und schließlich denjenigen, die sich nicht vorstellen können, wie komplex und anspruchsvoll Unterricht heutzutage ist bzw. sein kann und warum Lehrkräfte gelegentlich frustriert sind, wenn ihr Alltag hinter den Ansprüchen der evidenzbasierten Unterrichtsforschung zurückbleibt.
Klaus Dautel