Cod. Pal. germ. 423
Martin Luther: Schmalkaldische Artikel
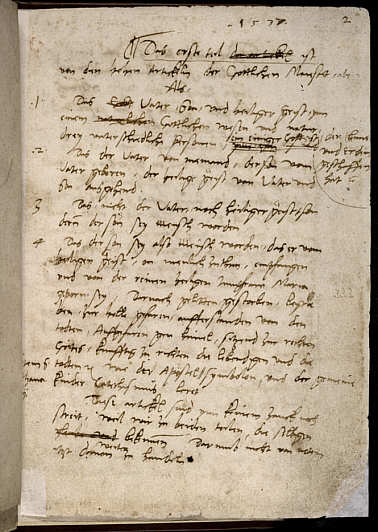 Beschreibstoff:
Papier Beschreibstoff:
Papier
Umfang: 27 Blätter
Maße: 21,8 x 15,8 cm
Entstanden 1536
Entstehungsort: Wittenberg
Die Schmalkaldischen Artikel gehören zu den bedeutendsten
Bekenntnisschriften, die Martin Luther verfasst hat. Der
sächsische Kurfürst Johann Friedrich hatte sie in Auftrag
gegeben, um sie auf dem von Papst Paul III. einberufenen
Konzil zu Mantua verlesen zu lassen. Allerdings hatten bereits
die Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes, des Verteidigungsbündnisses
der protestantischen Fürsten und Städte gegen die katholische
Religionspolitik unter Führung Kaiser Karls V., starke Vorbehalte
gegen die Artikel. Sie hatten sie für das Konzil, das die
Glaubens Spaltung beheben sollte, aber schlussendlich gar
nicht stattfand, als nicht geeignet empfunden. Im Jahre
1544 wurden die Schmalkaldischen Artikel zur Bekenntnisschrift
erhoben und 1580 in das Konkordienbuch als eine der Grundlagen
des evangelischlutherischen Glaubens mit aufgenommen. Die
Schmalkaldischen Artikel setzen sich hauptsächlich mit den
Lehren und Praktiken der römisch-katholischen Kirche auseinander,
die die Lutheraner ablehnen. Themen sind neben Erlösung,
Messe und Papsttum beispielsweise auch die Heiligen- und
Reliquienverehrung oder der Ablasshandel. Die Artikel wurden
von insgesamt 43 führenden Gelehrten unterzeichnet, u.a.
von Justus Jonas, Johannes Bugenhagen, Philipp Melanchthon,
Andreas Osiander oder Veit Dietrich.
Cod. Pal. germ. 423 ist in großen Teilen Autograph Martin
Luthers, d.h. das Manuskript wurde von ihm eigenhändig niedergeschrieben.
Ab Bl. 17r hat er den Text zwei Schreibern weiterdiktiert,
da er selbst anscheinend erkrankt war. Die Hs. entstand
zwischen dem 11. Dezember und Weihnachten 1536. Sie diente,
durch ein Vorwort und einige Zusätze Luthers ergänzt, als
direkte Vorlage des 1538 bei Hans Lufft in Wittenberg erschienenen
Urdruckes. Hierauf verweisen die zahlreichen, meist in Rötel
geschriebenen Setzerzeichen in der Hs. (u.a. Angaben zu
den Seitenumbrüchen, Bogensignaturen, Einfügungszeichen,
Angaben zu den zu verwendenden Typen), die mit dem angeführten
Druck übereinstimmen. Das Manuskript gelangte vermutlich
über Luthers letzten Famulus Johann Aurifaber (1519-1575)
in den Besitz Ulrich Fuggers (1526-1584), dessen Bibliothek
nach seinem Tod in den Besitz der Heidelberger Kurfürsten
kam und in die Bibliotheca Palatina integriert wurde.
Bild: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. pal.
germ. 423 f. 02r
Text: Matthias Miller /
Karin Zimmermann
|